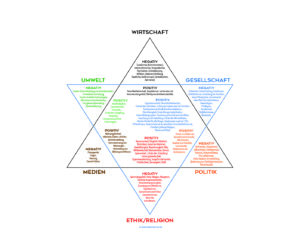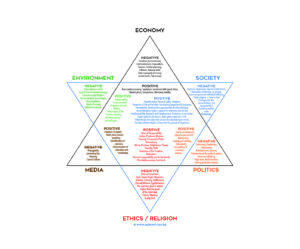16.07.2020, 13:57 | 1546 | 0 | 0
In dieser Artikelserie in drei Folgen geht es darum, Schülern, jungen Menschen und Erwachsenen, die sich noch nicht mit dem Thema ‚Wie funktioniert unsere Wirtschaft, wo kommt unser Wohlstand her‘ beschäftigt haben, einen leichten Einstieg in das Thema zu verschaffen und ein Grundwissen zu vermitteln. Hierfür bedarf es keiner mathematischen Formeln und es muss nichts auswendig gelernt werden. Es geht allein darum, bestimmte grundlegende Zusammenhänge des menschlichen Handelns zu verstehen. Geschichtliche Kenntnisse, zum Beispiel zur Herkunft des Geldes, helfen beim Verständnis.
Themen
Geld, Kredit, Zins
Finanzierung
Geldtheorien
Inflation, Deflation
Gelddrucken am Beispiel von ‚Monopoly‘ erklärt
Staatsverschuldung
Börse und Spekulation
Geld, Kredit, Zins
Gutes Geld ist die Basis unseres Wohlstands: Unsere Wirtschaft basiert auf Arbeitsteilung und Tauschhandel und all das basiert wiederum auf Vertrauen. Wenn das Vertrauen verloren geht, wird die Wirtschaftstätigkeit stark beeinträchtigt und es kommt zu erheblichen Reibungsverlusten.
Als Erstes muss man dabei verstehen, was „Geld“ ist, wie „Geld“ entstanden ist.
In den ersten Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte, als die Menschen Jäger und Sammler waren, gab es keine nennenswerte „Arbeitsteilung“: alle ‚jagten und sammelten‘ und es gab nur kleine sich selbst versorgende Einheiten, Familien, kleine Stämme.
Als die Menschen dann in größeren Gruppen zusammenlebten, Dörfern oder kleinen Städten, bildeten sich Spezialisierungen heraus, Berufe wie Schuhmacher, Schreiner, Schmiede entstanden. Diese Arbeitsteilung erhöhte die Effizienz stark, die Produktivität nahm zu.
Aus der arbeitsteiligen Wirtschaft ergab sich die Notwendigkeit, die jeweils produzierten Waren gegen andere zu tauschen, der Tauschhandel begann; zunächst wurden Waren direkt gegen andere Waren getauscht.
Um den Tauschhandel effizienter zu gestalten, wurden mit der Zeit manche Waren als ‚Geld‘, als Tauschmedium allgemein anerkannt. Dies war ein gesellschaftlicher Konsens, niemand wurde gezwungen, das zu akzeptieren, das ergab sich im Laufe der Zeit allein aus den Handlungen der Individuen.
Der Tausch ist die fundamentalste soziale Beziehung und der ‚Markt‘ ist der Dreh- und Angelpunkt einer Wirtschaft.
Auf einem ‚Markt‘ können Arbeitsleistungen und Güter sowie Dienstleistungen nur dann effizient getauscht werden, wenn es ein verlässliches und von allen Marktteilnehmern akzeptiertes Tauschmedium gibt. Aus diesem Bedürfnis der Marktteilnehmer entwickelte sich vor Tausenden von Jahren das „Geld“. Als Geld geeignet sind Waren, die leicht zu transportieren, haltbar und nicht beliebig vermehrbar oder reproduzierbar sind. Geld ist mithin auch eine Ware.
Das erste „Geld“ kam vor etwa 5000 Jahren in Gebrauch, und zwar bei den Sumerern. Es war das „Gerstengeld“. Dem Gerstengeld vertrauten die Leute, denn es war real und man konnte es essen. Weniger praktisch war, dass es recht schwer zu transportieren war. Auch Kühe wurden in manchen Regionen als Geld eingesetzt. Auch das war aber eher ‚unhandlich‘. Es war ein großer Durchbruch der Wirtschaftsgeschichte und erleichterte den Tauschhandel ungemein, als vor etwa 4500 Jahren in Mesopotamien die erste Silberwährung eingeführt wurde, der Silberschekel. Der Silberschekel war ein silbernes Gewicht (8,3 Gramm).
Die ersten Münzen aus Gold und Silber wurden um 640 vor Christus von König Alyattes in Lydien, in der heutigen Westtürkei, geprägt. Der Prägung war das Gewicht des Edelmetalls zu entnehmen. Solange die Menschen der Regierung vertrauten, die hinter der Prägung stand, vertrauten sie auch den von ihr herausgegebenen Münzen.
Praktisch in der ganzen Welt galten früher oder später Münzen aus Edelmetallen als Währung, es gab insofern quasi weltweit eine einheitliche Währungszone. Das erleichterte den internationalen Handel, der bereits in der Antike recht ausgeprägt war.
Als „Geld“ entstand, war es also immer eine Ware, die einen eigenen Nutzwert hatte. ‚Echtes‘ Geld entsteht wie jedes andere Gut oder jede andere Dienstleistung, es wird erarbeitet, z.B. dadurch, dass Gold geschürft wird. Alles andere ist „Geld-Ersatz“, ein Geld-Substitut, „Kredit-Geld“. Nur wenn mit Gold-Geld bezahlt wird, erhält der Verkäufer einen echten Gegenwert für seine Waren oder Dienstleistungen, andernfalls erhält er nur ein Zahlungsversprechen.
Betrogen wurde von den Emittenten des (Münz-)Geldes auch damals schon, und zwar indem man den Edelmetallanteil der Münzen manipulierte.
Der Betrug im richtig großen Stil wurde allerdings erst mit der Einführung des Papiergeldes (auch genannt ‚Fiat money‘) möglich.
Das erste Papiergeld wurde um das Jahr 1000 herum in China eingeführt, Ende des 13. Jahrhunderts versuchte sich der persische König mit Papiergeld finanziell zu sanieren. Das Papiergeld wurde üblicherweise unter Zwang eingeführt und die Experimente gingen nie lange gut. In Europa kam Papiergeld zuerst in Spanien Ende des 15 Jahrhunderts ins Spiel. Anfangs war das „Papiergeld“ in Europa meistens durch Gold oder Silber gedeckt, insofern als es sich um Quittungen handelte für bei Goldschmieden, Juwelieren oder Banken hinterlegtes Gold oder Silber, die beim jeweiligen „Emittenten“ eingelöst werden konnten. Diese leichter als der Gegenwert in Gold oder Silber zu transportierenden Quittungen wurden als Zahlungsmittel eingesetzt und erleichterten den Handel.
Bei „Papiergeld“ muss man unterscheiden in solches, das von dem Emittenten mit einem bestimmten Anspruch auf echte Werte/Güter, wie z.B. Gold, herausgegeben wird – also eine goldgedeckte Währung – und ‚fiat money‘-Papiergeld, das keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge an echten Waren repräsentiert; dieses Geld könnte man „Schuldengeld“ nennen, es ist ungedeckt und hat keinerlei eigenen Wert außer dem, der auf dem Vertrauen in das System beruht und entsprechend auch nur so lange existiert, wie das Vertrauen in das System besteht.
Der Wert von Papiergeld ist nicht ‚echt‘, denn der Wert des bedruckten Papiergelds existiert nur in unserer Fantasie und basiert auf dem Vertrauen, dass der Schuldner auch in der Lage ist, seine Schulden zurückzubezahlen.
Fiat-Geld ist ein Zettel, den der Emittent selbst nie mehr einlösen wird und für den der Inhaber des Zettels die Hoffnung haben kann, dass ihm ein Dritter dafür Waren gibt. Es ist also ein weitgehend leeres Versprechen beziehungsweise eines, das nicht dauerhaft fundiert ist.
Wenn Zentralbanken Geld in Umlauf bringen oder Geschäftsbanken über ihren Mindestreservesatzhebel frisches Geld kreieren, sind diese Gelder weitestgehend ungedeckt, es haften nur die Banken selbst. Alles baut auf dem Vertrauen auf, dass die Banken in der Lage sein werden, ihren Verpflichtungen nachzukommen – und oft genug in der Geschichte wurde dieses Vertrauen missbraucht
Wohin es führen kann, wenn der Staat exzessiv Geld druckt, konnte man in Deutschland in der Weimarer Republik in den Zeiten der Hyperinflation sehen; wir reden vor allen Dingen über das Jahr 1923.
Der Druck einer 500 Euro Note kostet fast nichts; problematisch wird es nur dann, wenn das Geld so weit entwertet ist, dass der Druck fast so viel kostet wie die frisch erzeugten 500,– Euro. Die Druckkosten lagen zum Schluss bei etwa einem Drittel des Wertes des bedruckten Papiers ausmachten – und das bei Scheinen im Nominalwert von 100 Billionen Mark. Für 100 Milliarden Reichsmark bekam man damals gerade mal ein Brot.
Im Jahr der Hyperinflation 1923 arbeiteten bis zu 133 Fremdfirmen mit fast 2000 Druckmaschinen Tag und Nacht für die Reichsdruckerei, um die Menschen jeden Tag mit frischem Papiergeld zu versorgen, das immer schon am selben Tag einen großen Teil seines Wertes wieder einbüßte. 30 Papierfabriken stellten das dafür erforderliche Banknotenpapier her. 30.000 Menschen und zahllose Lastwagen waren mit dem Druck und Transport der Scheine beschäftigt – es war eine immense Verschwendung von Ressourcen.
Das sollte im Übrigen auch denjenigen Umweltschützern zu denken geben, die gerade mit ihren „Green New Deals“ Tausende von Milliarden frisches Geld in Umlauf bringen möchten, um die Welt zu retten.
Eine weitere „Quelle“ frischen Geldes ist der ‚Kredit‘. Wenn im Geschäftsleben von knappem Geld oder einer Geldschwemme gesprochen wird, ist im Allgemeinen der Kreditmarkt gemeint, nicht das Bargeld. Über die durch die Zentralbank gedruckten Papiergeldscheine hinaus gibt es in einem ‚fiat-money‘-System das ‚Zentralbankgeld‘ beziehungsweise das ‚Buch- oder Giralgeld‘. Als Zentralbankgeld bezeichnet man die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, die durch Kredit auf hinterlegte Wertpapiere entstehen können oder durch eine ungedeckte Kreditvergabe der Zentralbank an die Geschäftsbanken. Buchgeld entsteht, wenn Geschäftsbanken an Endkunden Kredite vergeben. Über die Festsetzung der Quoten, die eine Bank als Eigenkapital und/oder Reserven vorhalten muss, entsteht eine große Hebelwirkung, die es den Banken erlaubt, ein Vielfaches der Kundeneinlagen und des Eigenkapitals als Kredite in Umlauf zu bringen. Diesen Hebel nennt man ‚Mindest-Reserve-Sätze‘, das System ‚fractional reserve banking‘. ‚Gedeckt‘ sind die Forderungen gegen die Banken zum größten Teil nur durch die Schulden Dritter.
Je niedriger die Mindestreserveanforderungen an die Geschäftsbanken sind, desto mehr fremdes Geld können die Banken auf eigene Rechnung verleihen und an der Marge Geld verdienen. Daher haben die Banken kein Interesse daran, den Hebel zum Geldverdienen zu verkleinern. Bei einem Mindestreservesatz von zum Beispiel 10% (der Einlagen) kann die Bank über fortlaufende Kreditgewährung Geld in Höhe des Zehnfachen der Einlage ‚schöpfen‘, bei einem Mindestreservesatz von 20% wäre nur das Fünffache möglich.
Der Staat hat ebenfalls kein Interesse daran, das System zu verändern und auf eine solide Basis zu stellen, denn mit der Geldflut finanziert er seine Bürokratie, die Wohltaten, mit denen Wählerstimmen gekauft werden und fragwürdige Abenteuer, wie Kriege, Energiewenden oder „Weltpolitische Maßnahmen“.
Die insgesamt vorhandene Geldmenge kann also rein technisch oder buchhalterisch stark erhöht werden, ohne dass sich gleichzeitig in der Realwirtschaft oder am Volksvermögen etwas tut.
Wenn Geld gedruckt wird, erhöht das nicht das Vermögen oder den Wohlstand der Bürger!
Dem globalen Geldvermögen steht als „Deckung“ ein ebenso hoher Betrag an Schulden gegenüber. Erst in zweiter Linie ist das Geld durch die vorhandenen Waren „gedeckt“, es gibt jedoch keinen Anspruch auf Erhalt einer bestimmten Warenmenge gegen Hergabe eines Papiergeldscheins. Und das kann dann zu Problemen führen, wenn der Besitzer der Ware dem Geld, das er im Gegenzug erhalten soll, nicht mehr traut und die „Annahme verweigert“.
Die Bürger sind mehr oder weniger per Gesetz gezwungen, das böse Spiel mitzuspielen, denn die Regierungen erklären ihr eigenes ungedecktes Geld zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel und verhindern aktiv die Entstehung von werthaltigeren Parallelwährungen.
Seit im Jahr 1971 die Golddeckung in USA endgültig abgeschafft wurde, leben wir in einer reinen ungedeckten Papiergeldwelt (‚fiat money‘) und die Staaten haben ihr Monopol auf das Geld seitdem weidlich ausgenutzt. Darauf aufbauend hat sich die globale Verschuldung in den letzten Jahren massiv erhöht, auf inzwischen über 250 Billionen US-Dollar (Stand 2020; gegenüber 173 Billionen zur Zeit der Lehman-Krise im Jahr 2007).
Dass unser derzeitiges System der fiat-Währungen bislang noch hält, liegt zum einen daran, dass es bislang wenig „Fluchtmöglichkeiten“ gab, da alle größeren Währungsräume parallel inflationieren, und zum anderen daran, dass den meisten Bürgern die Gefahren nicht bewusst sind – auch weil es bislang zumindest auf den Gütermärkten wenig wahrnehmbare inflationäre Tendenzen gibt (die ‚Inflation‘ spielt sich aktuell an den Immobilienmärkten und Wertpapiermärkten ab). Dass die offiziellen Preissteigerungsraten in den letzten 40 Jahren niedrig waren, ist der Sondersituation zu verdanken, dass über Demographie, die Globalisierung und hier vor allen Dingen die Einbindung von China in die Weltwirtschaft ein riesiges zusätzliches Arbeitsangebot auf den Markt gekommen ist, das die Löhne und die Warenpreise konstant gedrückt hat. Dieser Effekt wird sich jedoch vermutlich bald umkehren.
In der Geschichte hat noch nie ein ungedecktes Papiergeldsystem überlebt – und dieses Mal wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit genau so enden.
Dieses Mal könnte das Aufkommen der Kryptowährungen oder alternativer ‚privater‘ gold- oder anderweitig ‚gedeckter‘ Währungen dem Inflationieren der Staaten und ihrem fiat-money System ein Ende bereiten – nämlich dann, wenn das Vertrauen der Bürger in das ungedeckte Papiergeld weiter schwindet und sie diese Fluchtmöglichkeit vermehrt nutzen. Dann wird die massive ungedeckte staatsmonopolistische Geldschöpfung, der ‚Geldsozialismus‘, erneut als ein gigantischer Betrug an den Bürgern, ein riesiges „Ponzi-Scheme“ (Schneeballsystem) entlarvt werden.
“Gold is money, and nothing else.”
John Pierpont Morgan
Jetzt kommen wir zum ‘Preis’ des Geldes, dem ‚Zins‘, den der Kreditnehmer an den Kreditgeber bezahlt. Geld per se ist unproduktiv und generiert allein keine Rendite. Produktiv ist nur ‚Arbeit‘ im weitesten Sinn, die Arbeit des Unternehmers in Verbindung mit den anderen Produktionsfaktoren, darunter auch das ‚Kapital‘.
Ein Unternehmer kann benötigtes Kapital – z.B. für geplante Expansionen – aus dem Verkauf der von ihm produzierten Güter und den daraus erzielten Gewinnen generieren, oder aber am Markt als Kredit aufnehmen. Wenn er Kredit aufnehmen kann, kann er heute Rohmaterialien oder Maschinen kaufen, ansonsten muss er bis ‚morgen‘ warten, bis er selbst die entsprechende Liquidität aus seinen Gewinnen generiert. Das heißt, wenn der Unternehmer Kredit bekommt, kauft er nicht ‚Geld‘ sondern ‚Zeit‘. Den Zins bezahlt er dafür, dass er heute haben kann worauf er ansonsten bis morgen warten müsste.
Der Wert eines Gutes heute ist immer höher als der eines Gutes, das erst in der Zukunft zur Verfügung steht. Daher ist die gebräuchlichste Form eines kommerziellen Kredits die Diskontierung, bei der ein Kreditgeber, in der Regel eine Bank, dem Kreditnehmer für einen Zahlungsanspruch in z.B. 90 Tagen (Geldforderung, ‚Wechsel‘..) heute schon den Nennwert der Forderung abzüglich eines Betrags, der auf Basis des ‚Diskontsatzes‘ (Zinssatz) berechnet wird, ausbezahlt. Der Unternehmer bezahlt den Zins, wenn ihm das Geld heute entsprechend mehr Rendite liefern wird über seine unternehmerische Verwendung als er an Zinsaufwendungen haben wird.
Geld heute ist normalerweise immer mehr wert als Geld in der Zukunft (anders kann es unter verzerrten Marktbedingungen wie heute mit negativen Zinsen sein, Stand 2020). Es ist ein Vorteil, Geld heute in der Hand zu haben, anstelle von morgen. Man kann es dann ad hoc einsetzen bei günstigen Gelegenheiten oder zur Umsetzung interessanter Projekte. Geld an sich produziert allerdings keine Renditen. Wenn daher jemand anbietet, das Geld zu interessanten Konditionen zu leihen, und dieser Mehrwert die Vorteile übersteigt, das Geld sofort verfügbar zu haben, wird man es verleihen, wenn der entsprechende sofortige Zinsvorteil den möglichen zukünftigen Nutzen übersteigt. Der Verleiher diskontiert insofern auch Zeit.
Was wird also den Zins beeinflussen, den Preis von Geld? Nicht mehr und nicht weniger als Angebot und Nachfrage nach Geld.
Der ‚Marktzins‘ wird aber zusätzlich noch von psychologischen Faktoren beeinflusst, von Zukunftsperspektiven und den Einflüssen der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben einen sehr großen Einfluss auf die Höhe des Zinses, weil sie über ihr Geldmonopol wichtige Zinssätze ‚festsetzen‘ können. Ihre Macht ist aber nicht unbeschränkt und endet spätestens dann, wenn die Bürger das Vertrauen in das staatliche Papiergeld verlieren.
Bei der Bestimmung der Höhe des Marktzinses spricht man auch von der ‚Zeitpräferenz‘. Waren oder Dienstleistungen, die man heute bezieht, halten die Menschen in aller Regel für wertvoller als der Bezug derselben Leistung in der Zukunft. Und wenn Menschen ihr Geld verleihen und dafür auf Konsum verzichten, wollen sie dafür entschädigt werden – das ist der Preis des Geldes, der Zins. Die Höhe hängt ‚am Markt‘ davon ab, wieviel freies Geld zur Verfügung steht und wie viele Menschen sich Geld leihen möchten für Investitionen oder für vorgezogenen Konsum.
„Satisfaction of a want in the nearer future is, other things being equal, preferred to that in the farther distant future. Present goods are more valuable than future goods.
Ludwig von Mises
Finanzierung
Banken waren traditionell die Institutionen, zu denen die Sparer ihr Geld brachten und von denen die Unternehmer Kapital für ihre Investitionen erhalten konnten. Die Banken konnten, wenn sie ihre Sache ordentlich machten und die geplanten Investitionen ihrer Schuldner richtig einschätzten, an der sogenannten Zinsmarge gutes Geld verdienen. Bei den Zinsmargen unterscheidet man zwischen Sparmarge, der Transformationsmarge und der Kreditmarge.
Unternehmen haben jedoch auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Sie können Geld am Kapitalmarkt (Börse) aufnehmen in Form von Anleihen oder über die Ausgabe von Aktien (Beteiligungen) oder aber über private außerbörsliche Beteiligungen (Private Equity, Venture Capital). Aktien- und Anleihen-Platzierungen über die Börse lagen traditionell ebenfalls in den Händen der Banken und waren eine schöne Einnahmenquelle.
Wichtige Geldquellen für Unternehmen sind dabei Kapitalsammelstellen wie Fonds (offene Fonds oder geschlossene Fonds).
Finanzinnovationen machen die Banken jedoch seit einigen Jahren mehr und mehr entbehrlich (z.B. Crowd Funding, Kreditvermittlungsplattformen).
Geldtheorien
Es gibt verschiedene Geldtheorien. Entsprechend der Reihenfolge ihres historischen Auftretens sind zu nennen die ‚quantitative Theorie‘, die ‚qualitative Theorie‘ und die ‚Neutralitätstheorie des Geldes‘.
Die Quantitätstheorie wurde entwickelt, um den massiven Preisanstieg zu erklären, zu dem es in Spanien im 16. Jahrhundert aufgrund des enormen Imports von Edelmetallen aus den spanischen Kolonien in Südamerika kam. Der Wirtschaftswissenschaftler Jean Bodin (Frankreich 1502-1596) erklärte den Preisanstieg damit, dass der Wert des Geldes sich umgekehrt proportional zu dem Angebot von Gütern auf dem Markt verhalten würde. Je mehr Geld und je weniger Güter vorhanden seien, desto geringer der Wert, d.h. die Kaufkraft des Geldes, und umgekehrt.
Diese Theorie hat einen wahren Kern, leidet aber an zwei Irrtümern: Sie basiert auf der Annahme einer autarken Wirtschaft und darauf, dass das jeweilige Geld nur in dem einen Land eingesetzt werden kann. Tatsächlich aber zirkulieren sowohl Geld als auch Waren international und ein Land mit großem Geldangebot und einer Knappheit an Gütern kann ein reiches Land sein, wenn es jenseits der Grenzen Länder gibt mit Geldknappheit und einem Güterüberangebot.
Weiterhin basiert sie auf der Annahme, dass Geld nur ein Tauschmedium ist und nur zur Bezahlung von Gütern und Leistungen eingesetzt wird. Aber Geld hat noch weitere Zwecke, wie zum Beispiel die Vermögensaufbewahrungsfunktion und die Funktion, den Waren einen Wert zuzumessen.
Die ‚Qualitätstheorie‘ dagegen stellt nur auf den intrinsischen Wert der Edelmetalle ab, die das Geld enthält (John Locke, England, 1632-1704). Auch diese Theorie enthält einen wahren Kern, berücksichtigt aber nicht alle Faktoren. Nach dieser Theorie orientiert sich der Wert einer Währung allein oder zumindest vorrangig an den bei der Zentralbank hinterlegten Edelmetallbeständen. Diese Ansicht vernachlässigt aber wichtige Einflussfaktoren wie das Wirtschaftswachstum eines Landes, die vorhandene Infrastruktur, die Ausbildung der Menschen (das ‚Humankapital‘) oder den Kapitalstock.
Die Neutralitätstheorie hingegen sieht Geld nur als einen Wertmaßstab für Waren und Dienstleistungen an (David Hume, England 1711-1776 und John Stuart Mill, England 1806-1873). Geld und Waren hätten aber gegenseitig keinen Einfluss aufeinander. Diese Theorie geht fälschlich von einer vereinfachenden Annahme aus, dass alle Transaktionen am Markt letztlich Tauschgeschäfte seien. Im realen Leben steht zwischen dem Tausch von Gütern/Waren ein anderes Gut, nämlich Geld. Waren werden nicht unmittelbar gegeneinander getauscht sondern über den Umweg über Geld als Tauschmedium. Ein Tauschhandel (‚Barter Trade‘) ist direkt und bilateral, wogegen der ‚Markt‘, ausgedrückt in Geldpreisen, indirekt und multilateral ist. Daraus folgt, dass Geld, als eigene Ware, die jeweils ‚getauscht‘ wird, einen eigenen Wert haben muss, der von Marktfaktoren bestimmt wird, insbesondere durch bessere oder schlechtere Qualität und Knappheit oder Überschuss. Gegen Geld werden mehr oder weniger Güter eingetauscht, abhängig von dem Wert, der dem Geld zugemessen wird. Geld ist nicht gleich Geld. Manche Geldformen werden gegenüber anderen präferiert. Geld wird höher eingeschätzt, wenn es knapp ist, schlechter, wenn es im Überfluss vorhanden ist. Geld bleibt weiterhin ein Wertmaßstab für Güter, aber es ist eben auch selbst ein Gut, dessen Nutzwert abhängt von seiner Qualität (z.B. Material), seiner Funktion und dem Angebot und der Nachfrage nach diesem Geld.
Insofern müssen alle drei Geldwerttheorien (qualitativ, quantitativ, neutral) gemeinsam angewandt werden.
Inflation und Deflation
Inflation ist das Aufblähen der Geldmenge. Das Ansteigen der Preise ist nicht ‚Inflation‘ sondern das ist ‚Teuerung‘ oder ‚Preisinflation‘. Wenn die Geldmenge fällt, spricht man von ‚Deflation‘.
Die Preisinflation folgt der Inflation (dem Aufblähen der Geldmenge) erfahrungsgemäß in ‚normalen‘ Zeiten mit etwa einem Jahr Verzögerung und normalerweise liegt die Korrelation zwischen beiden Größen fast exakt eins zu eins. Das ist aber nicht zwingend.
„Nichts hat, worauf Lenin hingewiesen hat, eine so desorganisierende Wirkung wie eine Inflation: ‚um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muß man ihr Geldwesen verwüsten‘.“
Joseph Schumpeter
Wenn bei einer steigenden Geldmenge die Gütermenge im gleichen Verhältnis ansteigt, wird sich das Preisniveau zunächst einmal nicht verändern. Dabei erhöhen sich aber nicht alle Preise im gleichen Maße. In den letzten Jahren zum Beispiel gab es über Globalisierungseffekte und Billigimporte in manchen Bereichen sogar einen Preisdruck (Computer) und gestiegen sind bislang vor allem Vermögenspreise, das heißt unter anderem die Preise von Immobilien und Aktien. In den letzten hundert Jahren hätten die Güterpreise eigentlich insgesamt rapide sinken müssen, weil das Produktivitätswachstum der westlichen Länder seit der Industriellen Revolution gewaltig war.
Wenn die Menge des Geldes in den Händen der Konsumenten steigt oder fällt, können sie mit diesem Geld entsprechend mehr oder weniger Güter erwerben. Der Quotient aus der angebotenen Gütermenge geteilt durch die gesamte verfügbare Geldmenge ist, bei sonst gleichen Bedingungen, die Kaufkraft des Geldes – wie viel Ware bekomme ich für mein Geld.
Solange es noch die Golddeckung gab, kam es zu Inflation, wenn aus den Goldminen mehr Gold gewonnen wurde und ins Land gebracht wurde und im gleichen Wert mehr Geld in Umlauf kam. Wenn bei einem durch den Zufluss von Gold ausgelösten Anstieg der Geldmenge das Warenangebot nicht in gleichem Maß anstieg, kam es zu einem entsprechenden Preisanstieg.
Zu einer Deflation kam es, wenn durch technischen Fortschritt und eine wachsende Bevölkerung ein Überschuss von Waren produziert wurde, ohne dass sich die umlaufende Geldmenge entsprechend erhöhte.
Es gibt auch eine ‚Kostendrucktheorie der Inflation‘, diese Theorie wurde aber bereits um das Jahr 1870 herum von den Ökonomen Carl Menger, Walras und William Stanley Jevons widerlegt. Preisinflation wird immer von der Nachfrageseite her ausgelöst und nicht von steigenden Kosten der Produzenten – es sei denn, die Kostensteigerungen sind selbst wieder inflationsgetrieben.
Falsch ist auch die Theorie, Preisinflation sei eine Begleiterscheinung des Wirtschaftswachstums. Das Gegenteil ist richtig: Ein Mehr an Gütern bedeutet in aller Regel niedrigere Preise je Gut.
„Das Preisniveau kann ohne Ausweitung der Geldmenge nicht steigen; genauso wenig, wie der Wasserpegel einer Badewanne steigen kann, wenn man kein neues Wasser zugießt.“
Roland Baader
Auf breiter Fläche sinkende Preise sind nicht Deflation, sondern eine Folgeerscheinung der Deflation, einer schrumpfenden Geldmenge. Preise sinken regelmäßig auch aus anderen Gründen, wie zum Beispiel einem größeren Angebot, sinkender Nachfrage und einer gestiegenen Produktivität aufgrund technischen Fortschritts und neuer Maschinen.
Allgemein sinkende Preise kommen nur bei schrumpfender Geld- und Kreditmenge vor oder wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes abnimmt.
In einem Gold- oder Silberstandard kommt Deflation an sich nicht vor. Wenn Geld mit Gold oder Silber oder anderen Edelmetallen hinterlegt ist, kann die Geldmenge normalerweise nur langsam wachsen, da die Edelmetalle erst einmal geschürft und die Münzen oder Barren geprägt werden müssen. Und eine nennenswerte Schrumpfung der Geldmenge ist vor diesem Hintergrund auch schwer vollstellbar. Wenn dann über einen – durch Ersparnis ermöglichten – höheren Kapitaleinsatz oder sonstiger Einflussfaktoren, die die Produktivität erhöhen, mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden, auf eine unveränderte Geldmenge treffen, führt das tendenziell laufend zu leicht sinkenden Preisen. Und niedrigere Preise steigern den Wohlstand der Menschen, weil sie sich dann mehr leisten können.
Deflation ist nur dann wirklich kritisch, wenn sie Folge einer schrumpfenden Geldmenge ist. Das passiert in aller Regel, um inflationäre Fehlentwicklungen einer zuvor aufgeblähten Geldmenge zu korrigieren. Dennoch ist in dieser Situation die Deflation mit all ihren hässlichen und äußerst unangenehmen Folgen für die Menschen die einzig denkbare Kur für die vorherigen inflationären Übertreibungen. Je länger man damit wartet, desto schlimmer wird es, desto böser wird das Erwachen sein.
Der auch von vielen Ökonomen vertretene Irrglaube, sinkende Preise würden Deflation bedeuten und müssten gefürchtet und um jeden Preis verhindert werden, führt dazu, dass nötige Anpassungen verzögert werden und durch weitere Inflationierungsmaßnahmen die nachfolgende Krise verschlimmert wird (so zum Beispiel durch die Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken in der Corona-Krise). Zur Lösung einer deflationären Krise ist es leider sogar erforderlich, dass Preise und Löhne weiter sinken, bevor eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung möglich ist. Sinkende Preise und Löhne sind einerseits die Folge und andererseits auch das Heilmittel der (künstlich herbeigeführten) Deflation in Folge einer (künstlich herbeigeführten) Inflation.
Wenn die Preise ausreichend gesunken sind, werden die Menschen auch wieder mehr konsumieren und die Wirtschaft beginnt sich zu erholen. Wer das verhindert, verschlimmert und verlängert die Deflation. Deflation ist ein schmerzhafter Prozess der finanziellen Schrumpfung und Gesundung.
Wir fassen zusammen: Aus dem normalen Wirtschaftsgeschehen resultierende Inflation und Deflation ist im allgemeinen nicht problematisch, die Auswirkungen sind eher gering und können durch Preisanpassungen wieder bereinigt werden. Wenn Inflation und Deflation aber von Regierungen und Zentralbanken künstlich herbeigeführt werden, können die Folgen sehr ernst sein. Das haben die Ausführungen zur Weltwirtschaftskrise 1929 gezeigt.
Nur diese staatlich herbeigeführte Inflation (oder Deflation) ist gemeint, wenn man von den bösen Auswirkungen der Inflation spricht. Diese Form der Inflation entsteht, wenn eine Regierung, die Geld braucht, Zugriff auf die Geld-Druckerpresse hat. Den Staat kostet das Drucken frischen Papiergelds nichts außer den Kosten für Papier und Druck. Aber dieses frisch gedruckte Geld in der Hand des Staates ist nominal genau so viel Wert wie das Geld, für das die Bürger hart gearbeitet haben. Die zum Konsum verfügbaren Güter sind nicht mehr geworden durch das Gelddrucken und müssen jetzt aufgeteilt werden auf das neue und das alte Geld. Das ist ähnlich wie wenn man Wein mit Wasser verdünnt. Die Regierung gießt Wasser in den Wein des Volkes und beansprucht einen Teil des verdünnten Weines für sich selbst. Und finanziert damit seine eigenen Ausgaben, die Gehälter von mehr oder weniger nützlichen Bürokraten, mehr oder weniger sinnvolle staatliche Projekte oder von sinnlosen Kriegen, die besser vermieden worden wären.
Bei Lichte betrachtet werden alle diese Zahlungen finanziert mit einem Teil des Weines, der den Bürgern vom Staat entzogen wurde.
Das Ganze ist kaum besser oder anders, als wenn jemand heimlich einen Stromzähler umgeht, nicht für den verbrauchten Strom bezahlt und die Kosten der Allgemeinheit aufbürdet. Oder wenn ein Betrüger selbst illegal Geld druckt und in Umlauf bringt.
Durch solche Maßnahmen entzieht der Staat willkürlich den Bürgern einen Teil der Früchte ihrer Arbeit um es nach eigenem Gutdünken ‚umzuverteilen‘.
Besonders verwerflich ist, dass durch die Politik des willkürlichen Gelddruckens die Armen besonders geschädigt werden, denn ein Millionär spürt die Auswirkungen einer Wegnahme von 30% seines Besitzes deutlich weniger als ein Armer und der von einer Inflation ausgelöste Anstieg der Löhne kann in der Regel nicht mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten mithalten.
Als positiver Effekt der Inflation wird regelmäßig angeführt, dass sie den Schuldnern zu Gute kommen würde, da sie ihre Schulden mit ‚schlechterem‘ Geld zurückbezahlen könnten. Aber diese Theorie beruht auf der falschen Annahme, dass alle Schuldner arm und alle Kreditgeber reich seien. De facto bekommt aber jemand in der Regel nur Geld geliehen, wenn er Vermögen hat; niemand leiht einem Pleitier Geld. Die Kreditgeber sind, zumindest indirekt, die Anteilseigner der Banken und die große Masse der Sparer mit ihren Einlagen bei den Banken.
Auch eine künstlich herbeigeführte Deflation führt zu ungerechten Ergebnissen, da die am Ende des Inflationsprozesses aufgenommenen Kredite in schlechtem Geld von diesen neuen Kreditnehmer später mit gutem Geld zurückgezahlt werden müssen.
Aus diesen Gründen wird von vielen ‚stabiles Geld‘ gefordert als ideales Tauschmittel. Aber stabiles Geld ist unmöglich, denn wie jede Ware, ist Geld inhärent instabil. Unabhängig von staatlichen Interventionen gibt es viele unvorhersehbare Faktoren, die den Geldwert beeinflussen. Dennoch ist es erstrebenswert, dass Geld möglichst stabil ist, oder dass sich zumindest die Schwankungen in engen Grenzen bewegen und keine großen Auswirkungen haben.
Aber wie kann das erreicht werden?
Einige empfehlen, dass sich die umlaufende Geldmenge proportional zur Menge der angebotenen Gütermenge verhalten soll. Das ist aber schwerlich kontrollierbar und umsetzbar. Insofern müssten der Exekutive umfassende Vollmachten erteilt werden zur Regulierung der Geldmenge, was heutzutage auch in fast allen Ländern der Fall ist. Das Resultat einer solchen unglücklichen Politik ist heute allerorten zu beobachten.
Was den menschlichen oder sozialen Aspekt angeht, so vergrößern Inflation und Teuerung die Schere zwischen Arm und Reich, denn die zur Geldvermehrung betriebene Niedrigzinspolitik verbilligt den Kapitaleinsatz gegenüber dem Faktor Arbeit und lässt die Vermögenspreise der Investoren steigen. Geringverdiener und Rentner auf der anderen Seite können sich dem Kaufkraftverlust deutlich weniger entziehen. „Sozial“ ist etwas anderes.
Eine ungerechte Verteilung findet bei Inflation auch insofern statt, als diejenigen, die als erste Zugang zum neuen Geld haben, gewinnen gegenüber denjenigen, die erst später das neue Geld beziehen – das nennt man den ‚Cantillon Effekt‘.
Am Ende verlieren aber fast alle Leute, weil das ständig expandierende Geldangebot gigantische Blasen erzeugt, deren unvermeidliches Platzen Vermögenswerte und Ersparnisse zerstört, sowie zu Arbeitslosigkeit und weit verbreitetem Elend führt.
Wie ungerecht die Verteilungseffekte bei einer Inflationierung sind, zeigt zum Beispiel auch ein Chart von Thomas Piketty, der damit an sich nur auf die vermeintlichen Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Systems hinweisen möchte. Unverkennbar ist, dass die Einkommens- und Vermögensungleichheit sowohl in den USA als auch in Europa ab etwa dem Jahr 1971 tatsächlich stark zugenommen hat. Was hat sich in 1971 geändert? Im Jahr 1971 hatte der damalige US-Präsident Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben – nicht zuletzt um einige teure kriegerische Auseinandersetzungen zu finanzieren – und seitdem inflationierten alle westlichen Zentralbanken in immer größerem Stil. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Schere zwischen arm und reich seitdem auseinander geht, ist offensichtlich die schleichende Entwertung des Papiergelds durch Staaten und Zentralbanken durch Inflationierung und gerade nicht die freie Marktwirtschaft.
Die schlimmste Folge der Inflation im Papiergeldsystem ist der letzten Endes fast unvermeidliche Totalruin der Währung. Staatsbankrott und Währungsreform führen zum Totalverlust aller Geldvermögen der Bürger – eine Erfahrung, die die Deutschen im letzten Jahrhundert gleich zwei Mal machen mussten. Beide Male nach Kriegen, die zum guten Teil über die Druckerpresse finanziert worden waren.
Inflation und sporadische Währungsreformen sind in einem fiat money System regelmäßig angewandte Entschuldungsmethoden des Staates und somit geradezu systemimmanent.
Zu den negativen finanziellen Auswirkungen der Inflation kommt hinzu ein Zerfall der moralischen und gesellschaftlichen Ordnung, der am Ende oft in Chaos und Revolution mündet. Wenn Schuldenmachen belohnt und Sparsamkeit bestraft wird, wenn Klugheit, Vorsicht und Vernunft nichts mehr gelten, unterminiert das das bürgerliche ‚Geschäftsmodell‘, auf dem unser Wohlstand zu großen Teilen beruht.
„Schon beim Untergang des Römischen Reiches spielten die wechselseitig miteinander verbundenen Phänomene Militarisierung, Inflation und Überbesteuerung die Hauptrolle.“
Roland Baader
Ein Vorschlag, um den Werterhalt des Geldes zu sichern, ist die Rückkehr zu einem Goldstandard. Zu Zeiten des Goldstandards gab es die stabilste wirtschaftliche Entwicklung. Kurz nach der Aufhebung des Goldstandards in vielen westlichen Ländern begann der Erste Weltkrieg – Zufall hin, Zufall her.
Der Sinn und Zweck eines Goldstandards liegt weniger in einer absoluten Stabilität der Währungen – auch der Goldpreis schwankt in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage -, sondern darin, dass es die Staaten zu einer ordentlichen Haushaltsführung zwingt und Manipulationen an der Währung verhindert.
Am besten für die Stabilität des Geldes wäre es allerdings, wenn die Staaten ganz auf ihr Geldmonopol verzichten würden und konkurrierende private Währungen zulassen würden. Ein Beispiel für eine stabile silbergedeckte Privatwährung ist die ‚Mark Banco‘ der Privatbank ‚Hamburger Bank‘, die von 1629 bis 1875, als die Bank in die neu gegründete ‚Reichsbank‘ integriert wurde, einen stabilen Wert hatte.
Wenn man Politikern und Bürokraten Spielräume für Staatsverschuldung und Gelddrucken lässt, werden sie diese vermutlich leider früher als später ausnutzen.
In den letzten 200 Jahren gab es weltweit über 50 Hyperinflationen (von Hyperinflation spricht man im allgemeinen bei monatlichen Preissteigerungsraten von mehr als 50%) und auch die vermeintlich so stabile D-Mark hatte seit ihrer Einführung im Jahr 1948 bis zur Einführung des Euro im Jahr 1999 bereits etwa 95% ihres Wertes verloren.
„Nichts hat das deutsche Volk …. so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation.“
Stefan Zweig
Gelddrucken am Beispiel von ‚Monopoly‘ erklärt
Was bedeutet das Gelddrucken der Zentralbanken für den normalen Bürger?
Den meisten scheint das nicht klar zu sein, denn sonst würden sie dieses böse Spiel nicht in aller Ruhe mit sich spielen lassen. Es ist nämlich keineswegs so, dass das Gelddrucken am Vermögen der Bürger spurlos vorüber geht.
Was es für den einzelnen Bürger bedeutet, kann man an einem einfachen Beispiel aus dem Leben deutlich machen: Jeder hat vermutlich schon mal Monopoly gespielt.
Da bekommt jeder Spieler am Anfang eine genau bestimmte Menge Geld und kann damit Straßen kaufen, darauf wiederum Häuser und Hotels bauen und dafür Miete bei den Mitspielern kassieren.
Wenn man nicht genug Geld hat, kann man keine Straßen kaufen und die können von den Mitspielern weggeschnappt werden.
Wer die meisten Straßen und Häuser hat, verdient auch das meiste Geld.
Wer kein Geld mehr hat, scheidet vorzeitig aus.
Und wer am Ende am meisten Geld hat, gewinnt.
Fair ist das Spiel nur, wenn alle Spieler am Anfang des Spiels denselben Betrag an Geld erhalten und alle sich an die Regeln halten.
Man stelle sich jetzt vor, dass sich einer der Spieler das Recht nimmt, für sich selbst beliebig viel Geld frisch zu ‚drucken‘ beziehungsweise sich aus der Kasse der Bank so viel zu nehmen wie er möchte. Dieser ‚legale‘ Gelddrucker, Dieb oder Geldfälscher kann sich alles leisten, kann jeden Preis bezahlen und wird nie Pleite gehen.
Wer wird wohl gewinnen, wer verlieren?
Am Ende werden die ehrlichen Spieler Pleite sein – sie werden mit Sicherheit die Verlierer sein. Im richtigen Leben sind das die normalen Bürger.
Die unmittelbaren Gewinner sind der Staat und seine Nutznießer (Cantillon Effekt).
Und wenn das System am Ende unter den durch das Gelddrucken verursachten Schäden für die freie Wirtschaft zusammenbricht, wird es fast nur noch Verlierer geben.
Ein solch böses Spiel läuft so lange, wie es sich die Mitspieler gefallen lassen.
Beim Monopoly würden es sich die anderen Spieler von Anfang an nicht gefallen lassen, warum lassen sie es sich ‚im richtigen Leben‘ gefallen?
Die Antwort ist: Weil die meisten Bürger im richtigen Leben nicht merken oder merken wollen, welches Spiel der Staat spielt – obwohl es genau auf dasselbe herausläuft: der Bürger verliert, weil er betrogen wird.
Die meisten Bürger merken es nicht, weil die Regierungen die Wahrheit sehr gut verschleiern und die Zusammenhänge immer bewusst sehr abstrakt und unverständlich darstellen. Wer bezieht schon abstrakte Begriffe wie „Geldmenge“, “Bruttosozialprodukt“, „Beschäftigung“, „Außenhandelsüberschuss“ oder „Leistungsbilanzdefizit“ auf seine ganz persönliche Situation?
„Mit Gold als Geld – also mit echtem Geld – hätte weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg geführt werden können. Allenfalls drei Wochen lang.“
Roland Baader
Staatsverschuldung
„Verschuldung ist nichts weiter als vorgezogener Konsum, der in der Zukunft ausfällt.“
Dr. Hjalmar Schacht (Präsident der Deutschen Reichsbank)
Ein Staat finanziert sich über Steuern und Abgaben, die seine Bürger an ihn entrichten. Ein gut funktionierender Staat ist wichtig, ein großer Staatsapparat mit viel Bürokratie ist allerdings teuer. Die Gelder, die an den Staat fließen, stehen den Bürgern nicht mehr zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zur Verfügung. Es ist insofern wichtig, dass hier ein gesundes Maß gewahrt wird. Von der Antike bis über das Mittelalter hinaus begnügten sich Staaten und Herrscher mit etwa 10 Prozent, heute liegt die Staatsquote oft über 50%.
Über die negativen Einflüsse von staatlichen Eingriffen bis hin zur totalen Kontrolle durch Zentralplanung hatten wir schon gesprochen. Während die Keynesianer einen großen staatlichen Einfluss befürworten und dafür auch eine Schuldenaufnahme des Staates, lehnen das zum Beispiel ‚Die Österreicher‘ mit guten Argumenten ab.
Selbst Keynes verlangte jedoch, dass Staatsschulden nur in Krisensituationen aufgenommen werden sollen und in guten wirtschaftlichen Zeiten wieder abgebaut werden sollten – Letzteres wird allerdings praktisch nie umgesetzt.
Es gibt durchaus Situationen, in denen sich ein Staat verschulden können muss. Zum Beispiel in Krisenzeiten, wie Kriegen (dass auch Angriffskriege durch die ungehemmte staatliche Verschuldungsmöglichkeit erleichtert werden, ist allerdings negativ) oder (unverschuldeten) Wirtschaftseinbrüchen, zum Beispiel bei Eintritt der berühmten „Schwarzen Schwäne“. Zulässig sollte eine solche Staatsverschuldung, wie oben ausgeführt, aber auch dann nur unter der Bedingung sein, dass sie sofort bei einer Erholung zwingend wieder abgebaut wird.
Staatsschulden werden besonders problematisch, wenn sie so hoch ansteigen, dass die Zinszahlung schwierig wird und/oder das Vertrauen der Anleger schwindet (die ‚Bonität‘ sinkt) und die Aufnahme neuer Gelder erschwert oder unmöglich wird.
Staatsschulden sollten aus vielen Gründen nicht die Norm sein, sondern die Ausnahme. Das Geld, das der Staat für die Zinszahlungen aufwenden muss, steht nicht mehr für Investitionen in sinnvolle Bereiche zur Verfügung. Und auch wenn Staatsschulden fast nie zurückgezahlt werden, belasten sie immer die zukünftigen Generationen, die für den Schuldendienst aufkommen müssen. Wenn den Staatsschulden wenigstens noch sinnvolle staatliche Investitionen gegenüberstehen, die in gewisser Weise Erträge generieren, geht es noch, wenn das Geld aber verbraucht wurde, das heißt konsumiert, werden zukünftige Generationen das nicht mehr verbrauchen können, was ihre Vorfahren ‚verbraten‘ haben.
Staatsschulden sind in der Historie praktisch noch nie zurückbezahlt worden (sie wurden aber recht häufig durch Staatspleiten ‚bereinigt‘). Es gelang Ländern wie den USA oder England aber öfter, die Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung (und das ist die relevante Kennziffer) deutlich abzubauen – in der Regel erfolgte das über großes Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen. Ein solcher relativer Schuldenabbau ist allerdings leider die Ausnahme.
Stand 2020 (vor Corona) beläuft sich die deutsche Staatsverschuldung einschließlich der „impliziten Verschuldung“ in Höhe von 5,6 Billionen Euro, inzwischen auf über 220% der jährlichen Wirtschaftsleistung (die offizielle Staatsverschuldung liegt bei ‚nur‘ 60%). Die implizite Verschuldung ist eine ‚heimliche‘, verschleierte Verschuldung, die sich aus zukünftigen Leistungsversprechen wie Grundrente, Mütterrente etc. zusammensetzt. Sie wird in den normalen Statistiken nicht erfasst – belastet aber die zukünftigen Generationen.
Börse und Spekulation
Börsen sind Handelsplätze für Wertpapiere (Aktien, Anleihen), Waren, Devisen und Derivate (u.a. Optionen und Terminkontrakte). An der Börse investieren Menschen investieren oder sie sichern Transaktionen ab oder spekulieren. Nur weil an Börsen auch spekuliert wird, sind sie kein kapitalistisches Teufelszeug. Börsen haben eine sehr wichtige Funktion im Wirtschaftsleben, denn über sie kann man einfach und schnell Transaktionen absichern und Geld investieren. Absichern können sich zum Beispiel Bauern, indem sie ihre zukünftigen Ernten schon auf Termin verkaufen können oder Firmen, die Rohstoffe auf Termin einkaufen und so eine sichere Kalkulationsbasis haben. Ein Juwelier, der goldene Ringe liefern muss, kann sich durch den Kauf von Gold auf Termin gegen den Anstieg des Goldpreises absichern. Gegen Spekulation ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Spekulanten spielen an der Börse sogar insofern eine wichtige Rolle, als sie Liquidität beisteuern und dadurch die Abwicklung von Transaktionen erleichtern.
Es steht auch jedem frei, mit eigenem Geld zu spekulieren, man sollte es nur nicht mit fremden Geld machen (Other Peoples‘ Money) und man sollte die Verluste verkraften können. Wenn Spekulanten ihr eigenes Geld verlieren, ist davon der Rest der Bevölkerung nicht betroffen.
An der Börse können Menschen, wenn sie sich damit auskennen, ihr Geld sinnvoll investieren und Vermögen aufbauen, zum Beispiel für ihre private Altersvorsorge. Dass recht viele Anleger an der Börse Geld verlieren, bedeutet nicht, dass Börsen an sich schlecht sind. Sie sind grundsätzlich für die meisten Menschen sogar der sinnvollste Weg zu einer guten Geldanlage. Auch an der Börse wachsen die Bäume jedoch nicht in den Himmel und selbst die wenigsten ‚Profis‘ verdienen langfristig mehr als ihre ‚Benchmark‘ (die Vergleichsrendite, in der Regel sind das Börsenindizes, letztlich reden wir über den Durchschnitt der Rendite vergleichbarer Anlagen).
Verluste treten ein, wenn man die falschen Entscheidungen getroffen hat. Emotionen wie Gier und Angst sind sehr schlechte Ratgeber. Wenn man über ein gutes Fachwissen verfügt und sich diszipliniert an bestimmte Regeln hält, lässt sich bei einem mittel- bis längerfristigen Anlegerhorizont mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der Börse Geld verdienen. Wichtig ist, dass die Kosten niedrig gehalten werden und Timingfehler (falscher Ein- und Ausstiegszeitpunkt, oft aus Gier oder Angst) vermieden werden.
Eine der unter diesen Aspekten aus Anlegersicht erfolgreichsten Strategien ist der Aufbau eines passiv verwalteten ETF-Portfolios (ETF = Exchange Traded Funds), bei dem das Portfolio immer nur bei Bedarf an die vorher festgelegten Gewichtungen angepasst wird und aktive Entscheidungen vermieden werden. ETFs sind Fondsanlagen, die sich in aller Regel an einem Index orientieren, bei denen es keine aktiven Anlageentscheidungen gibt und die vergleichsweise sehr niedrige Gebühren haben. Wer in Aktien investiert, sollte mindestens einen Anlagehorizont von 5 Jahren haben, besser noch von 10 Jahren.
Auch Staaten, Versicherungen und Pensionsfonds investieren an den Börsen. Länder wie Norwegen oder arabische Erdölproduzenten investieren einen Teil der Einnahmen aus dem Ölverkauf global in Wertpapiere und Beteiligungen, um für zukünftige Generationen Vermögen aufzubauen. Die Investitionsentscheidungen werden aber nicht von Bürokraten getroffen, sondern von gut ausgebildeten Profis.
Auf keinen Fall sollten Staaten mit den Steuergeldern spekulieren, die sie ihren Bürgern zwangsweise abnehmen.
Die Bürger können selbst an der Börse investieren oder spekulieren, dafür brauchen sie keine staatliche Bürokratie. „Eigenes“ Geld hat ein Staat nicht, auch die oben erwähnten Öleinnahmen, die zwar an den Staat fließen, sind letztlich das Geld der Bürger der jeweiligen Länder und auch das Geld der zukünftigen Generationen.
Wenn die Bürger wollten, dass der Staat für sie an der Börse spekuliert oder investiert, dann könnten sie dem Staat zum Beispiel zielgerichtet und freiwillig Geld in speziell dafür aufgelegte Fonds geben, die der Staat verwaltet – was allerdings vermutlich kein vernünftiger Mensch tun würde.
Es folgt Teil 3
Autor: Markus Ross