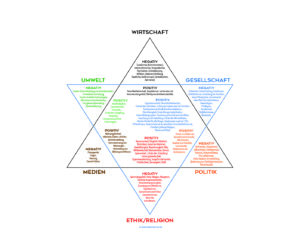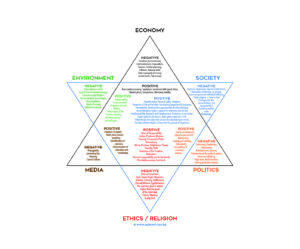Zyklen sind ein fester Bestandteil der Natur und begleiten das menschliche Leben. Sie sind insofern auch im Bereich einer Volkswirtschaft ganz normal.
Sie sind auch so lange nicht schlimm, als sie nicht zu exzessiv werden, denn besonders heftige Abschwungphasen können zu großen finanziellen Zerstörungen und zu viel menschlichem Leid führen. Das Risiko, dass es zu einer sehr ernsten Krise kommen kann, vergleichbar mit der Großen Depression, der Weltwirtschaftskrise 1929, ist durch den Corona-Lockdown und die vorangegangenen Krisen gerade stark gestiegen.
Warum kommt es zu Rezessionen, Krisen oder Depressionen?
Betrachten wir zunächst die ‚normalen‘ Auf- und Abwärtsbewegungen der Wirtschaft.
Der ökonomische Prozess besteht aus drei Phasen: Produktion, Distribution und Konsum. Sie sind Phasen eines lebendigen und dynamischen Zyklus, die nicht losgelöst voneinander nacheinander ablaufen, sondern in einem bestimmten Rhythmus, wie Zahnräder ineinandergreifend. Die Zeit ist bei diesem Prozess ein wichtiger Faktor, denn Produktion und Vertrieb müssen finanziert werden. Zeit ist Geld. Die Wirtschaft ist, wie das menschliche Leben, nicht statisch oder gleichmäßig ‚pulsierend‘. Regelmäßig kommen nicht planbare neue Technologien auf oder „disruptive Ereignisse“, wie Erdbeben, Kriege oder Pandemien.
Der Ökonom Joseph Schumpeter hat sich eingehend mit den Konjunkturzyklen beschäftigt. Unter Bezug auf den russischen Ökonomen Nikolai Kondratieff unterscheidet Schumpeter primär zwischen drei unterschiedlichen Zyklen beziehungsweise Wellenbewegungen. Er spricht von Kondratieff-Wellen, die 40-60 Jahre dauern, sowie Juglar-Wellen mit einer Dauer von 7-10 Jahren und Kitchin-Wellen, die durchschnittlich 40 Monate dauern. Die jeweils neuen Kondratieff-Wellen werden seiner Ansicht nach durch revolutionäre ‚Basisinnovationen‘ ausgelöst, die nach ihrer Entdeckung und ihrem breiteren Einsatz in der Praxis ‚die Welt verändern‘.
Bis heute hat man folgende Kondratieff-Wellen identifiziert:
Erste Welle: Industrielle Revolution bis 1780-1840
Zweite Welle: Dampfmaschine und Stahl, 1840-1897
Dritte Welle: Elektrizität, Chemie ab 1898 – 1940
Vierte Welle: Petrochemie und Automobil 1940 -1990
Fünfte Welle: Informations- und Kommunikationstechnik 1990 –
Die Sechste Welle, die irgendwann im Anschluss auf die fünfte Welle beginnen wird, könnte zum Beispiel ausgelöst werden durch Erfindungen im Bereich Künstliche Intelligenz, Nanotechnologie oder Biotechnologie.
Innovationsschübe werden ausgelöst über bahnbrechende Erfindungen. Geforscht wird immer, allerdings nicht immer mit dem gleichen Elan. Unternehmen geben laufend viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um in ihrem Bereich technologisch führend zu sein (in den Bilanzen findet man die entsprechenden Ausgaben unter ‚F+E‘; englisch: Research and Development, R+D). Große Veränderungen und neue Kondratieff-Zyklen treten ein, wenn neue Erfindungen Lösungen bieten für Probleme, die im alten Zyklus aufgetreten sind und dort starkes weiteres Wachstum verhindert hatten. Radikale, basisinnovative Lösungen werden zum ‚game changer‘. Die einmal von innovativen und risikofreudigen Unternehmern in den Markt eingeführten Basisinnovationen (zum Beispiel ‚Amazon‘) setzen sich mit zunehmender Geschwindigkeit durch, mehr und mehr Kapital fließt in solche Verwendungen, alte Konzepte verlieren dadurch immer weiter an Rentabilität.
Das grundlegende Prinzip des ökonomischen Prozesses ist nicht ein Gleichgewicht, sondern das Ungleichgewicht. Dass vieles dafür spricht, dass eine freie Wirtschaft immer in Richtung eines Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage tendiert, ist dabei kein Widerspruch. Auch wenn es die Tendenz zum Gleichgewicht gibt, ist Ungleichgewicht der vorherrschende Zustand. Gleichgewicht würde zu ökonomischer Stagnation führen; Ungleichgewicht ist die treibende Kraft, die die Wirtschaft am Leben hält und zu Fortschritt führt. Das Wirtschaftsleben ist nicht Ruhe, Friede und Sicherheit; es verlangt Unruhe, Drang, Risiken und Abenteuer. Weitere Antriebsfaktoren sind die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und der Wunsch und das Bestreben, Dinge besser zu machen, Abläufe effizienter zu gestalten, Zeit zu sparen – ‚effektiver‘ zu werden.
Auf Aufschwungphasen folgen regelmäßig Phasen der Abschwächung, die dann auch immer mit einer gewissen Arbeitslosigkeit verbunden sein werden (gemeint sind nicht ausgewachsene ‚Boom‘ und ‚Bust‘-Phasen, die an anderer Stelle besprochen werden). Eine freie Wirtschaft hat jedoch innere automatische Mechanismen, die selektive Störungen durch die Marktkräfte korrigiert. Wenn eine Ware zu viel produziert wird und das Angebot die Nachfrage übersteigt, führt das so lange zu fallenden Preisen bis die Produktion reduziert wird und sich die Preise wieder stabilisieren. Und umgekehrt. Es gibt jedoch auch Zeiten, bei denen diese Selbstheilungskräfte anscheinend nicht funktionieren, es zu Fehlanpassungen kommt und sich eine handfeste Wirtschaftskrise entwickelt.
Als ausgewachsene ‚Wirtschaftskrise‘ bezeichnet man eine ernste Abschwungphase mehr oder weniger der gesamten Wirtschaft, die zu einer wirtschaftlichen Depression führt. Wir betrachten aber an dieser Stelle nur Krisen, die nicht durch externe, exogene Schocks wie Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege, Revolutionen oder disruptive neue Technologien oder Entdeckungen ausgelöst wurden, sondern nur ‚hausgemachte‘, endogene Krisen.
Die Frage nach den Ursachen der Entstehung solcher Krisenphasen ist eine der wesentlichen Fragen im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften. Nur wenn man hierzu Erkenntnisse gewinnt, können Lösungen gefunden werden, um solche Krisen künftig zu vermeiden.
Liegen die Ursachen in der Freien Marktwirtschaft selbst begründet oder vielleicht mehr in staatlichen Eingriffen in die freie Wirtschaft?
Bei den Konjunkturtheorien stehen sich hauptsächlich die ‚Überinvestitionstheorie‘ (Ludwig von Mises, Österreichische Schule) und die ‚Unterkonsumptionstheorie‘ (John Maynard Keynes, Merkantilisten) gegenüber.
Unter den Phänomenen, denen die klassischen Ökonomen und ihre Widersacher (Adam Smith & Co., Marx) im Rahmen ihrer Forschung und Beobachtungen begegneten, waren Krisen, Monopole und Arbeitslosigkeit. Daraus schlossen sie, dass diese besonderen Erscheinungen zwangsläufig mit dem Kapitalismus oder der Freien Marktwirtschaft verbunden seien.
Dies ist jedoch aus den folgenden Gründen nicht richtig:
Im Allgemeinen drückt sich die ökonomische Krise so aus, dass die Umsätze zurückgehen und der Markt die angebotenen Produkte nicht mehr absorbiert. Das führt im Normalfall seitens der Unternehmer zu einer reduzierten Produktion und der Entlassung von Arbeitern
Ökonomen wie die Merkantilisten oder Keynes erklären die Entlassungen in Folge eines reduzierten Güterabsatzes mit einem ‚Unterangebot von Geld‘ bzw. einer ‚Überproduktion‘, einem ‚Überangebot von Waren‘. Diese Erklärungsversuche sind aber nicht überzeugend. In einem ehrlichen Geldsystem (nicht ‚fiat money‘) werden die Waren zwangsläufig mit einem übereinstimmenden Geldangebot in Umlauf gebracht. Wenn das Geldangebot klein ist, sinken die Preise, aber es gibt keine flächendeckenden Störungen der Wirtschaft. Der Wert der Waren sinkt, der Wert des Geldes steigt und alle Güter werden absorbiert. So haben es schon Adam Smith und Jean-Baptiste Say erklärt und bislang konnten sie nicht überzeugend widerlegt werden.
Mit ‚Überproduktion‘ ist gemeint, dass die Produzenten mehr Güter produzieren als Bedarf besteht, so dass ein Überschuss an Gütern vorliege, eine Güterschwemme, und die Konsumenten, obwohl sie das erforderliche Geld dafür hätten, die Güter nicht kaufen.
Dagegen ist einzuwenden, dass es bis zum heutigen Tag noch nie eine Situation gegeben hat, wo auf der Welt genug Güter für alle produziert worden wäre. Das große ökonomische Problem der Welt ist die Knappheit, nicht der Überschuss. Eine generelle Überproduktion von Gütern ist ein Mythos, eine unhaltbare realitätsferne These und keine tatsächliche reale Begebenheit. Es kann mancherorts mal zu einem Überangebot bestimmter Güter kommen, aber nie von allen Gütern gleichzeitig. In solchen Fällen treten dann die bereits angesprochenen Mechanismen in Kraft und normale Verhältnisse werden wiederhergestellt, ohne dass es zu nennenswerten Störungen kommt, wobei durchaus bei dem Anpassungsprozess einzelne Produzenten Pleite gehen können, die sich verkalkuliert haben.
Das ist dann ein Fall von ‚ungleichmäßiger Produktion“, den eine dritte Krisen-Theorie als Erklärung heranzieht. Aber solche selektiven, lokalen und vorübergehenden ‚Produktionsstörungen‘ in Folge von Pleiten können keine Krise als Phänomen einer allgemeinen wirtschaftlichen Störung erklären.
Auch eine freie Marktwirtschaft hat zwangsläufig ihre Zyklen, aber diese fallen weniger heftig aus und Lösungen werden schneller gefunden, wenn unternehmerische Profis am Werk sind und nicht staatliche Dilettanten. Jede Verzerrung der Marktsituation durch staatliche Maßnahmen – seien es Zinsmanipulationen, Preiskontrollen bei Gütern und Löhnen, staatliche Restriktionen etc. – führt dazu, dass notwendige Anpassungen sehr viel langsamer erfolgen oder gänzlich verhindert werden.
Karl Marx und die Sozialisten erklären Krisen als Resultat der ‚Konzentration des Kapitals‘. Die Produzenten würden ihre Gewinne, die sie der Gesellschaft ‚entziehen‘ beziehungsweise vorenthalten, akkumulieren und würden dadurch die Kaufkraft der Massen reduzieren. Wenn die Produzenten dann später ihre Gewinne in zusätzliche Produktionsmittel investieren und für den Bau weiterer Fabriken zusätzliche Arbeitskräfte benötigen, fließen zusätzliche Gelder an die Arbeiter und stehen diesen für den Konsum zur Verfügung. Dadurch kommt es zu einem Preisanstieg, da zu diesem Zeitpunkt dem erhöhten Geldzufluss noch keine zusätzlichen Konsumgüter gegenüberstehen, da sich die zusätzlichen Produktionsmittel noch im Aufbau befinden und noch keine Waren produzieren. Sobald aber die zusätzlichen Produktionsmittel ihren Betrieb aufnehmen, kommt es zu einem Überangebot von Gütern am Markt, das nicht aufgenommen werden kann – woraus eine Krise entsteht.
Auch diese Erklärung ist allerdings fehlerhaft, da nie alle Produzenten gleichzeitig Gewinne einheimsen, sparen oder investieren, sofern dieses Verhalten überhaupt auf einzelne Produzenten zutrifft. Eine allgemeine Krise könnte allenfalls ausgelöst werden, wenn sich alle Produzenten absprechen und synchron gleich verhalten würden, was eine unrealistische Annahme ist.
Die „Währungs-Schule‘ (England, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) und die ‚Wiener Schule‘ versuchten, das Problem der Krise von der Währungsseite her zu begreifen.
Wie bereits dargestellt hat Geld neben seiner Tauschmittelfunktion noch andere Funktionen und Auswirkungen, die ihm ein ‚Eigenleben‘ verschaffen. Wenn in den Geldwert eingegriffen wird, wird das Geld von einem Regulator des ökonomischen Lebens zu einem Störfaktor.
Wirtschaftliche Krisen entstehen nicht aus einem Mangel an Geld sondern aus einem Überfluss an Geld.
Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Inflation immer Krisen ausgelöst. Wenn Inflation bei einem normalen wirtschaftlichen Verlauf auftritt, so stört das nicht das Gleichgewicht des Marktes. Was ökonomisch schädlich ist, sind die nachteiligen Effekte, die aus staatlicher Inflationspolitik resultieren. Insofern muss man unterscheiden zwischen natürlicher Inflation und einer Kreditausweitung im Rahmen einer Politik des ‚billigen Geldes‘. ‚Natürliche‘ Inflation kann beim normalen Gang der Dinge entstehen, wenn die Geldmenge schneller steigt als das Güterangebot; z.B. als Gold aus den Kolonien nach Europa kam, insbesondere nach Spanien.
Wenn allerdings Regierungen die Druckerpresse anwerfen, um für sich das Geld zu generieren, mit dem sie oftmals wenig sinnvolle öffentliche Projekte oder eine wuchernde Bürokratie finanzieren möchten, kommt es sowohl zu Inflation als auch gleichzeitig zu einer Kreditausweitung, da die öffentlichen Ausgaben die Entwicklung und das Wachstum eines Landes über die normalen Bedürfnisse und Verhältnisse hinaus steigern. Dadurch entstehen Unternehmungen und Projekte, die am Markt ohne weitere staatliche Hilfe nicht überlebensfähig sind.
Zu einer Kreditausweitung kommt es, wenn die Regierung einen Produktionsanstieg über das normale Niveau hinaus erzwingen möchte und dazu ‚Ressourcen mobilisiert‘ (die meisten dieser teuren Ressourcen werden dabei leider verschwendet). Hierzu wird Geld für diejenigen bereitgestellt, die ihre Produktion in den Bereichen ausweiten möchten, die von der Regierung als vorteilhaft für ein Land angesehen werden (Sonnenenergie, Windenergie, Elektroautos u.s.w., u.sw.). Das löst eine Boomphase aus: Fabriken werden gebaut, Maschinen produziert oder importiert, das Ganze wird noch obendrein von einer weiter ausufernden, teuren Bürokratie begleitet. Das frische Geld fließt durch viele Hände und führt am Markt zu erhöhter Nachfrage nach Konsumgütern, deren Angebot sich aber nicht vergleichbar erhöht hat. Nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage führt das zu steigenden Preisen (selbst wenn die Regierung Preisobergrenzen festgelegt haben sollte). In Anbetracht der steigenden Preise steigen in der Folge auch die Löhne. Es entsteht eine Wohlstands- oder Wachstumsillusion – alle fühlen sich reicher. Dann kommt es allerdings irgendwann zu dem Punkt, an dem das für die Produktionsausweitung zur Verfügung stehende Geld aufgebraucht ist und die neu kreierten Unternehmungen alleine überleben müssen. Viele sind dazu aber nicht in der Lage. Einige besonders schlecht geplante Unternehmungen gehen recht bald Pleite da sie sind nicht konkurrenzfähig sind, andere haben starke Umsatzeinbußen. Eine Krise entsteht: Preise sind gestiegen, das Geld hat an Wert verloren, sinnvolle Produktionskapazitäten sind nicht gestiegen, Umsätze gehen zurück, Arbeiter verlieren ihre Jobs, die Arbeitslosigkeit steigt und eine schmerzhafte Anpassungsphase (Readjustierung) beginnt.
Die Politik der Kreditexpansion hat – anstatt den Wohlstand der Nation zu mehren – einen großen Teil des vorher vorhandenen Wohlstands zerstört.
Wenn man auf Illusionen aufbaut, kommt die Enttäuschung meist schneller als langsamer.
In einer wirklich freien Marktwirtschaft werden so große Krisen nicht entstehen können, da dort deutlich weniger Fehlanreize gesetzt werden. Bei einer Staatsquote von 40 Prozent oder mehr allerdings ist der Staat, der die größten Fehlanreize setzt, der größte und mächtigste Spieler am Markt – mit entsprechend schädlichem Einfluss.
Krisen sind nicht die Folge einer freien Marktwirtschaft oder zwangsläufige Begleiterscheinungen davon. Sie sind im Gegenteil die Folge von politischen Eingriffen in die freie Marktwirtschaft.
Wirtschaftstheorien
Eine Wissenschaft, die ihren Namen rechtfertigt und Fortschritt für die Menschen bringen soll, muss sich ein Bild der Wirklichkeit verschaffen, darauf basierend belastbare Theorien entwickeln und diese laufend überprüfen und nötigenfalls korrigieren. In Bereichen wie Chemie und Physik kann man Theorien mit Experimenten überprüfen, im Bereich der Sozialwissenschaften ist das schwieriger, da man mit Menschen nicht so leicht experimentieren kann und zum Beispiel psychologische Faktoren nicht exakt vorherbestimmbar sind.
Wenn man die Welt aufmerksam und unvoreingenommen beobachtet, kann man Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten erkennen. Aus diesen Beobachtungen und Erkenntnissen können im nächsten Schritt Theorien entwickelt werden zur Erklärung der festgestellten Abläufe. Diese Theorien müssen anschließend fortlaufend kritisch hinterfragt, überprüft und gegebenenfalls angepasst oder weiterentwickelt werden. Ludwig von Mises bezeichnet diese Herangehensweise an das Forschungsthema im Bereich der Wirtschaftswissenschaft als „Praxeologie“, die Logik des menschlichen Handelns.
“The method of imaginary constructions is indispensable for praxeology; it is the only method of praxeological and economic inquiry. It is, to be sure, a method very difficult to handle because it can easily result in fallacious syllogisms. It leads along a sharp edge; on both sides yawns the chasm of absurdity and nonsense. Only merciless self-criticism can prevent a man from falling headlong into these abysmal depths.”
Ludwig von Mises (Human Action, Seite 238)
Im Bereich der Landwirtschaft haben Generationen von Gärtnern und Landwirten die Natur beobachtet und dabei sehr viele Erkenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt gesammelt und über Witterungsverhältnisse in Abhängigkeit von den Jahreszeiten. Daraus konnten sie dann Prognosen über die Ernte ableiten oder Empfehlungen, wann am besten mit der Aussaat begonnen werden sollte. Diese Beobachtungen flossen unter anderem in die allseits bekannten lustigen „Bauernregeln“ ein.
So wenig aber wie die Bauernregeln immer stimmen, so wenig lassen sich allerdings auch im wirtschaftlichen Bereich exakte Vorhersagen machen.
„Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“
Mark Twain
Umfassende wissenschaftliche Studien ökonomischer Phänomene entstanden zeitgleich mit der Entwicklung der heutigen modernen industriellen Wirtschaft. Einhergehend mit den Fortschritten bei Produktion, Kommunikation, Transport und Finanzwirtschaft entwickelte sich auch die Ökonomie als Wissenschaft weiter, ständig wurden neue Erkenntnisse gewonnen und flossen in die Theorien ein. Umgekehrt wurden auf Basis der theoretischen Erkenntnisse die praktischen Abläufe kontinuierlich weiterentwickelt. Sowohl unser aktuelles Wirtschaftssystem, das zurecht oder zu Unrecht, als ‚Kapitalismus‘ bezeichnet wird, als auch die heute bekannten Ökonomischen Theorien sind allesamt erst im Gefolge der Industriellen Revolution entstanden.
Der Mensch verhält sich zwar auch unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht immer strikt rational, aber auf jeden Fall war er seit Urzeiten tendenziell bestrebt seine Lebensumstände, heute würden wir ‚Lebensstandard‘ sagen, zu verbessern. Die weit verbreitete Annahme, dass der Mensch ein reiner ‚Nutzenmaximierer‘ ist, ein sogenannter ‚Homo Oeconomicus‘, ist allerdings nicht ganz richtig. Bei menschlichen Entscheidungen spielen immer auch andere Aspekte eine Rolle als der reine wirtschaftliche Nutzen.
Im Laufe der Zeit fing der Mensch an zu ‚sparen‘, um Güter zu einem späteren Zeitpunkt konsumieren oder um sie später teurer verkaufen zu können. Geld und Güter wurden verliehen, man tat sich zusammen, um gemeinsam effizienter zu produzieren. Große Denker der Geschichte, wie Platon und Aristoteles, beschäftigten sich bereits vor mehr als 2000 Jahren mit der ‚Wirtschaft‘ und Themen wie Arbeitsteilung, der Höhe von Mieten, ob Maschinen mal die Sklavenarbeit ersetzen könnten oder auch dem Unterschied von Tausch- und Gebrauchswert. Die schon von Aristoteles erkannte Arbeitsteilung ist einer der wesentlichen Faktoren, um die Produktivität der Menschen zu erhöhen.
Der Absolutismus löste in Europa im 16. und 17. Jahrhundert den Feudalismus des Mittelalters ab, in dem der Monarch seine Macht noch mit dem Adel teilen musste. Das Aufkommen der absolutistischen Monarchien führte auch dazu, dass die Wirtschaft des Landes weitgehend durch den Staat kontrolliert und gesteuert wurde. Das Wirtschaftssystem des Absolutismus nennt man den „Merkantilismus“. Der Merkantilismus, der primär den Interessen der Herrschenden diente, hatte allerdings katastrophale wirtschaftliche Folgen für die Bevölkerung. Deren schlechte wirtschaftliche Lage war einer der Gründe, die zur französischen Revolution führten.
Die Misere der Bevölkerung, das Aufkommen der „Aufklärung“ (etwa ab 1650) und in dem Zuge auch die Wiederentdeckung der Lehren und Werke der alten griechischen Meister (Platon, Aristoteles) führten schließlich zum Aufkommen des Liberalismus. In Frankreich entstand im Vorfeld noch die ‚physiokratische Schule‘, deren Lehren vor allen Dingen in England auf fruchtbaren Boden fielen. Aus dieser Zeit stammt das geflügelte Wort des ‚Laissez faire‘, das meistens mit der liberalen Wirtschaftstheorie in Verbindung gebracht wird und das bedeutet, dass der Staat sich möglichst nicht in die Wirtschaft einmischen soll.
‚Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même!‘
Vincent de Gournay (1751, ‚Physiokratie‘)
Die ersten bekannten umfassenden wirtschaftswissenschaftlichen Theorien entstanden dann im Zuge der industriellen Revolution in England, durch die sogenannten „Klassiker“, von denen Adam Smith (1723-1790) und David Ricardo (1772-1823) die bekanntesten sind. Sie beobachteten die wirtschaftliche Entwicklung und versuchten Erklärungen zu finden und Gesetzmäßigkeiten zu ergründen für Phänomene wie Konjunkturzyklen und Krisen, Arbeitslosigkeit, oder auch die Entstehung und die Wirkung von Monopolen. Ihre Theorien bauten auch auf einer Kritik des Merkantilismus auf, des bis dahin vorherrschenden Dogmas, denn von einer sauberen wissenschaftlichen theoretischen Begründung auf Basis sorgfältiger Analysen des Verhaltens aller Teilnehmer des Wirtschaftszyklus kann man beim Merkantilismus noch nicht sprechen.
Dass sich die Klassiker, trotz solider „Grundlagenforschung“ und guten, zum Teil auch heute noch gültigen Denkansätzen, langfristig nicht durchsetzen konnten, liegt daran, dass manche der behaupteten „Gesetzmäßigkeiten‘ nicht zutrafen, dass der propagierte bedingungslose Freihandel für die damals weniger entwickelten Wirtschaftsnationen wie Deutschland und USA nicht nur Vorteile hatte, aber vor allem deshalb, weil sie ihre Sache schlecht ‚vermarkteten‘. Ihren Gegnern gelang es mit viel Propaganda und der Unterstützung vieler ‚Intellektueller‘, die Tatsachen zu verdrehen und den Liberalismus in einem sehr schlechten Licht darzustellen. Obwohl auch gerade die Arbeiter und unteren Klassen sehr stark von dem vom Kapitalismus ausgelösten Wohlstandsanstieg im Rahmen der Industriellen Revolution profitierten, gelang es den Gegnern der freien Marktwirtschaft, der Bevölkerung vorzugaukeln, dass der Kapitalismus nur den Interessen der Reichen (Kapitalisten) dienen würde und schlecht für die Massen sei, die zunehmend ‚verelenden‘ würden. In Wirklichkeit – auch wenn es den Massen aus heutiger Perspektive damals wahrlich noch nicht so richtig gut ging und vieles im Argen lag – hatten die Arbeiter ein deutlich besseres Versorgungsniveau als in den Jahren zuvor und vor allen Dingen auch verglichen mit ihrer Lage im Agrarzeitalter (noch im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel auch in Europa einige Hungersnöte mit vielen Toten).
Zu den aufkommenden Gegnern des Kapitalismus gehörten der ‚nationalistische Protektionismus‘ und der Sozialismus in seinen verschiedenen Ausprägungen -wie dem ‚wissenschaftlichen Sozialismus‘ von Karl Marx und Friedrich Engels und der ‚Historischen Schule‘ des Gustav von Schmoller. Allen gemeinsam ist diesen die Staatsgläubigkeit auf der einen und Misstrauen in die Entscheidungen der Individuen auf der anderen Seite sowie nationalistische Tendenzen und sozialistisches Gedankengut. Alle gemeinsam kann man als ‚Neomerkantilismus‘ bezeichnen. Die moderne merkantilistische Version ist der Keynesianismus, oder heute die Modern Monetary Theory (MMT).
„Üble Missstände zu erzeugen und dann anderen die Schuld zuzuweisen, ist geradezu das Wesen der Politik.“
Gary Galles (‚Greedy Bastard Economics‘).
Während der Liberalismus mit dem Grundgedanken des freien Handels, der bestmöglichen Verfolgung der wirtschaftlichen Interessen der Bürger und einem vergleichsweise schwachen Staat tendenziell friedensstiftend wirkt, ist eine Wirtschaftsideologie, die die nationalistischen Interessen eines starken Staates in den Vordergrund stellt, eher konfliktfördernd. Der Neomerkantilismus begann im Deutschland Bismarcks und schwappte von da nach England, USA, Frankreich und in andere Länder über.
Liberale führen den Ausbruch der beiden Weltkriege, die jeweils die internationale Arbeitsteilung weitgehend zerstörten, auch auf die zunehmend nationalistische Wirtschaftspolitik der Länder zurück.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam mit den sogenannten „Neoklassikern“ eine weitere interventionistische Wirtschaftstheorie auf, quasi als Synthese aus Keynesianismus und verschiedenen Gleichgewichtstheorien (Alfred Marshall und Leon Walras). Im Ergebnis propagiert auch diese Theorie staatliche Einflussnahme, um Nachfrage zu generieren und damit Vollbeschäftigung anzustreben.
Bei den ganzen verschiedenen Wirtschaftstheorien geht es letztlich um zwei wesentliche Denkrichtungen, die zwei unterschiedliche Gesellschaftsmodelle und Wirtschaftssysteme favorisieren und jeweils „wissenschaftlich“ bzw. theoretisch zu rechtfertigen versuchen:
Auf der einen Seite der ‚Sozialismus‘, verbunden mit Planwirtschaft, Zentralplanung, Interventionismus und einem starken Staat.
Auf der anderen Seite der ‚Kapitalismus‘ auch liberale, ‚freie Marktwirtschaft‘ genannt, verbunden mit der Idee eines schlanken Staats, der nur den rechtlichen Ordnungsrahmen setzt und sich ansonsten auf seine Kernaufgaben konzentriert: Sicherheit nach außen und innen, Justiz, Infrastruktur.
Bildung zum Beispiel kann auch sehr gut oder sogar besser privat organisiert werden. Hierbei ist allerdings dafür zu sorgen, dass alle Kinder einen Zugang zu guter Bildung haben müssen. Dies kann zum Beispiel privat über Stipendien erfolgen, über Steuererleichterungen und übergangsweise auch mittels staatlicher Unterstützung erfolgen.
Die Österreichische Schule
Die Österreichische Schule geht auf Carl Menger (1851-1914) zurück, der etwa ab dem Jahr 1870 daran arbeitete, die Ökonomie wissenschaftlich weiter zu untermauern.
Ökonomie, als Lehre vom wirtschaftlichen Handeln der Menschen mit dem Ziel, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu befriedigen, kann keine exakte Wissenschaft sein, anders als Chemie oder Biologie oder Physik, wo man mit Experimenten Ergebnisse erzielen kann.
Bei der Ökonomie aus Sicht der Österreichischen Schule geht es darum, Erkenntnisse aus dem Studium des menschlichen ökonomischen Handels abzuleiten, zunächst einmal unabhängig von philosophischen oder moralischen Fragen und auch unabhängig von Geschichte, Geographie und Politik und sonstigen exogenen Faktoren. Ökonomie soll beschreibend sein und nicht wertend.
Eine grundlegende Aussage sowohl der ‚Klassiker‘ als auch der ‚Österreicher‘ ist, dass die Preise das wesentliche Instrument für die richtige Steuerung der Wirtschaft sind – und zwar die Preise, die sich an einem freien Markt über Angebot und Nachfrage bestimmen. Ohne die Informationen, die die Preise liefern, lassen sich keine guten ökonomischen Entscheidungen treffen. Eine ökonomische Wirtschaftsrechnung ohne Preise ist praktisch nicht möglich. Zu den Preisen gehört auch der Zins. Die Österreichische Schule basiert auf einer guten Analyse der Realität und ihre Schlussfolgerungen und Aussagen gelten als vernünftig.
Dass es in einer Planwirtschaft keine ‚Marktpreise‘ gibt, ist das Hauptproblem aller sozialistischen Länder. Primär daran sind bisher alle sozialistischen Experimente gescheitert, und eine Lösung ist nicht in Sicht.
Neben Carl Menger sind Ludwig von Mises (1881-1973), Eugen Böhm von Bawerk (1851-1914) und Friedrich von Hayek (1899-1992) die bekanntesten Persönlichkeiten der Österreichischen Schule.
Keynesianismus
Der Keynesianismus ist seit fast 100 Jahren die wirkmächtigste Wirtschaftsideologie in der westlichen Welt – und das, obwohl sie ‚handwerklich‘ schlecht gemacht ist, auf vielen falschen Annahmen beruht und vor allen Dingen auch in der Realität bereits mehrfach widerlegt wurde.
‚Keynesianismus‘ ist eine extrem staatsorientierte, sozialistisch-merkantilistische Wirtschaftsideologie, die dem Staat eine zentrale Rolle im Wirtschaftsleben zuschreibt – mit entsprechend viel Macht und Einfluss für Politik und Bürokratie. Und genau darin liegt auch die Ursache begründet für seinen dominierenden Einfluss in der westlichen Welt: Politiker und Bürokraten lieben Macht, Einfluss und Zugriff auf die Geldtöpfe eines Landes. Und Keynes liefert ihnen dafür die „wissenschaftliche“ Rechtfertigung.
Der Keynesianismus geht auf das 1936 im Zeichen der Weltwirtschaftskrise veröffentlichte Buch von John Maynard Keynes zurück „The General Theory of Employment, Interest, and Money“.
Wie wir später sehen werden, ist die Weltwirtschaftskrise letztlich mehr oder weniger genau durch die Maßnahmen und staatlichen Einflussnahmen entstanden und in ihrer Dauer verstärkt worden, die Keynes später zur Bewältigung der Probleme vorschlägt.
Einer dieser Vorschläge sei an dieser Stelle schon einmal zitiert:
“If the Treasury were to fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depths in disused coalmines which are then filled up to the surface with town rubbish, and leave it to private enterprise on well-tried principles of laissez-faire to dig the notes up again…there need be no more unemployment and, with the help of the repercussions, the real income of the community, and its capital wealth also, would probably become a good deal greater than it actually is. It would, indeed, be more sensible to build houses and the like; but if there are political and practical difficulties in the way of this, the above would be better than nothing.”
John Maynard Keynes (General Theory, 1936, p. 68)
Wirtschafts- und Finanzkrisen
Von der Weltwirtschaftskrise 1929 (The ‚Great Depression‘) über die „Sub-Prime“-Krise 2008 bis zur Corona-Krise 2020.
Die Weltwirtschaftskrise begann im Jahr 1929 nach einem mehrjährigen Boom, der von einer enormen Börsenhausse begleitet war. Die dann folgende Krise hatte hinsichtlich Dauer und Ausmaß eine bis dato unbekannte Dimension und prägte so das Denken der Menschen für lange Zeit.
Über die Gründe für die im Jahr 1929 beginnende katastrophale Entwicklung gibt es die unterschiedlichsten Ansichten. Auf jeden Fall gilt wohl auch für diesen riesigen Crash, dass je größer die vorangegangene Boom-Phase ist, desto größer auch die darauffolgende ‚Bust-Phase‘ ausfällt.
In der Realwirtschaft kam es in der damaligen Zeit ohnehin zu größeren Umbrüchen, die sicher auch ohne vorangegangenen Boom zu einigen Pleiten und vorübergehender Arbeitslosigkeit geführt hätten: in der Landwirtschaft zum Beispiel wurden durch den Einsatz neuer Maschinen viele Arbeitskräfte freigesetzt.
Allerdings hatten sich auch die Vereinigten Staaten von Amerika bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts – wie auch alle anderen westlichen Staaten – mehr und mehr interventionistisch und wohlfahrtsstaatlich verhalten. Die Staatsquote stieg prozentual beträchtlich an, im Jahr 1913 wurde eine bundesstaatliche Einkommenssteuer eingeführt und mit der Einrichtung der Zentralbank (Federal Reserve System ‚FED‘) im selben Jahr und dem damit einhergehenden staatlichen Geldmonopol wurden die Schleusen zu einer seitdem stetig steigenden Staatsverschuldung und Geld- und Kreditausweitung geöffnet.
Nachdem die US-Wirtschaft im Jahr 1924 einen Einbruch verzeichnet hatte, löste die FED in Kooperation mit dem Geschäftsbankensystem eine massive Kreditexpansion aus. 1927 wurde dann eine weitere Inflationswelle ausgelöst, so dass die umlaufende Geldmenge zwischen 1924 und 1929 insgesamt um etwa 25% anstieg. Industrie, Finanzsektor und Staat verschuldeten sich kräftig weiter, Aktien- und Immobilienpreise stiegen massiv an.
Inflation und Kreditexpansion bewirken aber immer Fehlanpassungen und Fehlinvestitionen in der Wirtschaft, die früher oder später wieder bereinigt werden müssen – was im Jahr 1929 begann.
Auch im Jahr 1857 hatte es eine ernste Krise gegeben, die sich, ausgelöst in New York über den ganzen Globus ausbreitete, Banken und Unternehmen in die Pleite riss und Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz kostete. Auch diese Krise wurde als „Weltwirtschaftskrise“ bezeichnet. Ausgelöst wurde sie durch einen Spekulationsboom und unter anderem durch den Zufluss von viel spekulativem Geld aus Europa.
Seit 1929 kam es zu verschiedenen weiteren ernsten Wirtschaftskrisen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten alle westlichen Länder erst einmal für einige Zeit ein ansehnliches Wirtschaftswachstum und geringe Arbeitslosigkeit vorzuweisen. Mit Unterstützung des 1948 eingeführten amerikanischen Marshall-Plans (European Recovery Program, ‚ERP‘) wurde die daniederliegende Wirtschaft der europäischen Länder kräftig angekurbelt. In Deutschland sprach man von dem „Wirtschaftswunder“, das primär dem damaligen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard (1897-1977) zu verdanken ist, einem Anhänger der Österreichischen Schule. Ludwig Erhard veranlasste 1946 parallel zur Währungsreform, dass die meisten staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft, wie Preiskontrollen, abgeschafft wurden.
Über großes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig relativ niedrigen Zinsen gelang es den westlichen Ländern zunächst, ihre kriegsbedingt sehr hohe Staatsverschuldung deutlich zu senken. Allerdings führte das Wirtschaftswachstum dazu, dass die Staaten den Wohlstand mehr und mehr umverteilen wollten, die Steuern und Staatsquoten stiegen laufend weiter an.
Die Freude wurde durch die Ölkrise 1973 erstmals nachhaltig gedämpft. Zur Zeit des Jom-Kippur-Krieges der Araber gegen Israel begann die arabische Erdölorganisation OPEC mit einer Ölverknappung, die den für die westlichen Industriestaaten wichtigen Rohstoff Rohöl in kurzer Zeit massiv verteuerte. Allein im Oktober 1973 stieg der Ölpreis um 70% und innerhalb eines Jahres verdreifachte sich der Preis. Die Folge war eine massive Wirtschaftskrise in den westlichen Ländern.
Am 19. Oktober 1987, „Schwarzer Montag“ genannt in Anlehnung an die Bezeichnung „Schwarzer Donnerstag“ für den Tag des New Yorker Börsencrashs vom 24. Oktober 1929, der die Weltwirtschaftskrise einleitete, kam es zu dem bislang größten Börsen-Crash der Nachkriegszeit: der amerikanische Aktienindex „Dow-Jones“ verlor innerhalb von Stunden fast ein Viertel seines Wertes. Auslöser waren steigende Zinsen und ein hohes Handelsdefizit, aber vor allen Dingen ein massiver Kursanstieg in den vorangegangenen Monaten, der die Bewertung der Aktien zu stark nach oben getrieben hatte. Kursanstiege und Boomphasen, die durch leichtes Geld ausgelöst werden, enden in der Regel recht abrupt, sobald der Zufluss frischen Geldes versiegt oder aber die Zinsen zur Eindämmung inflationärer Effekte erhöht werden.
„Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober.“
(Mark Twain)
Wenn Krisen sich nicht ‚auf natürlichem Wege‘, das heißt ohne staatliche Einflüsse, bereinigen und im Gegenteil die Krise erneut mit frischem Geld bekämpft wird, kann es kurzzeitig zu einer Verbesserung kommen – allerdings wird dadurch die Saat für die nächst größere Krise gelegt.
Im März 2000 platzte die „Dot-Com“-Börsenblase. Hier verloren zwar viele Anleger Geld und einige Firmen gingen Pleite, die Auswirkungen für die Realwirtschaft hielten sich allerdings in Grenzen. Der deutsche Aktienindex DAX fiel von seinen Höchstständen im März 2000 bis zum Jahr 2003 um über 70%. Im Vorfeld waren Aktien aus dem Bereich ‚New Economy‘ primär mit Bezug zum Internet massiv gestiegen, Firmen, die noch nie einen Cent Gewinn gemacht hatten, wurden mit Milliarden bewertet. An der Börse wurde das entsprechende Marktsegment, der Neue Markt, im Jahr 2003 komplett aufgelöst. Die Verluste am ‚Neuen Markt‘ vom Höchststand im März 2000 beliefen sich zum Schluss auf etwa 95%.
Im Jahr 2007 begann die Weltfinanzkrise (auch „Sub-Prime-Krise“ genannt), in der wir uns letztlich an sich auch heute noch befinden. Auch hier waren im Vorfeld die Immobilienpreise und Börsenkurse stark gestiegen, auch wieder einmal stark beeinflusst durch staatliche Eingriffe. Nach dem Platzen der Dot-Com-Blase und den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatte die amerikanische Zentralbank eine sehr expansive Geldpolitik betrieben und diese auch längere Zeit nicht beendet, obwohl die US-Wirtschaft bereits wieder ordentlich wuchs, und zwar weil die Arbeitslosigkeit trotz Wirtschaftswachstum hoch blieb; es wurden nur wenige neue Jobs geschaffen. Kapitalzuflüsse aus dem Ausland hatten den Preisanstieg bei Immobilien und Aktien weiter verstärkt, eine neue Spekulationsblase war die Folge. Und wie jede Blase, platzte auch diese irgendwann.
Der Staat hatte die Blase noch dadurch vergrößert, dass er die Banken sogar mit gesetzlichen Regelungen gezwungen hatte, Immobilienkredite an nicht-kreditwürdige Immobilienkäufer für Schrottimmobilien zu vergeben. Die Ratingagenturen (unter anderem Standard & Poors, Moodys und Fitch), hatten willfährig hochproblematische Pakete von solchen Schrottimmobilienkrediten mit Bestnoten versehen und viele institutionelle Anleger – besonders auch aus Deutschland – hatten die wertlosen Kredite in Milliardenhöhe gekauft.
Als erste ernstere Zweifel an der Nachhaltigkeit der Immobilienbewertungen aufkamen, brachen die Kurse der involvierten Banken ein und viele gingen Pleite beziehungsweise mussten mit viel staatlichem Geld (Steuergeld!) gerettet werden. Ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt hatte die Krise am 15. September 2008 als die große amerikanische Investmentbank Lehman Brothers zusammenbrach. Kurzzeitig bestand damals sogar die Gefahr des Zusammenbruchs des gesamten globalen Banksystems. Um das zu verhindern, versorgten die Staaten das Finanzsystem mit gigantischen Geldsummen, was dazu führte, dass die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung so stark anstieg, dass deren Bonität sank und einige Staaten selbst vor der Pleite standen. Sogenannte ‚systemrelevante‘ Firmen wurden mit Steuergeldern gerettet, in Deutschland zum Beispiel die Commerzbank – man sprach von ‚too big to fail‘. Aufgrund der Tatsache, dass diese Firmen in den guten Zeiten ihre Gewinne in Form von Dividenden an die Eigentümer ausgeschüttet hatten, jetzt aber der Steuerzahler zu ihrer Rettung einspringen musste –nach dem Motto: ‚Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren‘ – spricht man bei einer solchen Situation von ‚moral hazard‘. Der moralische Fehlanreiz liegt darin, dass man viel Geld gewinnt, wenn die Spekulation aufgeht und – wenn es schiefgeht – ein anderer die Zeche bezahlen muss; in diesem Fall der Steuerzahler. Für den ‚Moral-Hazard-Bankier‘ ist das eine „Win-Win-Situation“.
Weltweit beliefen sich die Wertpapierverluste infolge der Krise auf etwa 4 Billionen US-Dollar. Der DAX zum Beispiel fiel um etwas über 50% von etwa 8000 Ende 2007 auf 3700 im März 2009.
Die Finanzkrise schlug auch auf die Realwirtschaft durch, auch viele große Unternehmen, wie zum Beispiel General Motors, mussten Insolvenz anmelden.
Um die Folgen der Krise zu mildern, hielten die Zentralbanken in den daraufffolgenden Jahren die Zinsen erneut künstlich niedrig – zusätzlich zu der enormen Menge an frischem Geld, das sie in die Märkte pumpten.
In Europa schloss sich die im Jahr 2009 beginnende ‚Eurokrise’ nahtlos an, die auch bis heute noch nicht gelöst ist. Auslöser der Krise war die Erkenntnis, dass Griechenland mehr oder weniger Pleite war. Griechenland hatte über Jahre die eigenen Verschuldungszahlen gefälscht und bereits die Aufnahme in den Euro hatte sich Griechenland mit sehr kreativen Buchungen erschlichen. Bei der Eurokrise kommen insofern Aspekte einer Staatsschuldenkrise, einer Bankenkrise und einer Finanzkrise zusammen.
Im Frühjahr 2010 erklärt Griechenland, dass es seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Hilfe der EU nicht mehr nachkommen könne, dann folgt im Herbst Irland. Die EU-Kommission schätzte, dass die EU-Mitgliedsländer 2010 neue Schulden von rund 870 Milliarden Euro anhäufen werden. Als im Jahr 2011 auch Spanien und Italien in Schwierigkeiten geraten, verschärfte sich die Krise weiter. Die Hauptkrisenländer wurden in den Medien mit den Kürzeln „PIIGS“ oder „GIPSI“ bedacht.
Die Probleme im Euroraum gehen auf die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung EURO zurück, die im Januar 1999 eingeführt wurde. Von vielen Fachleuten wurde bereits im Vorfeld vor der Euroeinführung in Ländern gewarnt, die international weniger konkurrenzfähig sind als andere Euro-Teilnehmer, da Länder wie Italien, Spanien, Portugal, Griechenland aber auch in gewissen Maßen Frankreich ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in früheren Jahren nur dadurch erhalten konnten, indem sie ihre eigenen nationalen Währungen ständig abwertenden – was bei einer einheitlichen Währung nicht mehr möglich ist.* Seitdem steht die Frage eines Auseinanderbrechens des Euro im Raum. Alternativ auch der Ausschluss von Griechenland aus dem Euro.
„Ich glaube, dass die Einführung des Euro den gegenteiligen Effekt haben wird. Sie wird politische Spannungen verschärfen, indem sie divergente Schocks, die durch Änderung der Wechselkurse leicht hätten gemildert werden können, zu umstrittenen politischen Themen macht.“
Milton Friedman
„Während die Lohnstückkosten – also die Lohnkostenvorteile im Verhältnis zur Arbeitsproduktivität – zwischen 2000 und 2007 in Griechenland (128,6%), Spanien (127,7%), Italien (123,6%), Portugal (122,3%) und Irland (133,6%) in den Himmel schossen, blieben sie in Deutschland erst konstant und sanken ab 2004 sogar.“
Wolfgang Steiger und Simon Steinbrück
Im Jahr 2011 weitete sich die Eurokrise zu einer ausgewachsenen „Weltfinanzkrise“ aus. Am
8. August 2011 entzog die Ratingagentur Standard & Poors (S+P) den U.S.A. die Ratingbestnote AAA. Die Folge war ein massiver Kurseinbruch. Der 8. August 2011 wird „Schwarzer Montag“ genannt.
In der Folge stieg die globale Staatsverschuldung kräftig weiter an, die Zinsen wurden weiter künstlich niedrig gehalten und die Börsen haussierten weiter.
Bis Anfang des Jahres 2020 die ‚Corona-Krise‘ begann. Ausgelöst wurde sie durch eine aus China kommende Virus-Epidemie oder ‚Pandemie‘, in deren Folge die meisten Regierungen weltweit die heimische Wirtschaft praktisch von einem auf den anderen Tag über angeordnete ‚Lock-Down‘-Maßnahmen massiv drosselten und viele Firmen in den Ruin trieben. Inzwischen (Mitte Juni 2020) ist die Arbeitslosigkeit in Amerika fast so hoch wie in der Weltwirtschaftskrise. Um die Pleitewelle ein bisschen einzudämmen und die Menschen wenigstens ein Stück weit vor den staatlich verordneten Einbußen zu schützen, legten die Regierungen weltweit gigantische schuldenfinanzierte Förderprogramme auf, die die weltweiten Staatsschulden allerdings drastisch weiter erhöhen – und eine geordnete Finanzierung beziehungsweise Rückführung der Staatsschulden inzwischen fast unmöglich machen.
„Vom vormaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss stammt der Satz: ‚Die abendländische Kultur ist von drei Hügeln zu uns herabgestiegen: Von der Akropolis, vom Kapitol und von Golgatha.‘ Die Fluten des Papiergeldes haben diese drei Hügel schon längst überspült.“
Roland Baader
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die aufeinanderfolgenden Krisen immer größere Ausmaße annehmen. Aus Sicht der Österreichischen Schule ist das insofern nachvollziehbar als die Staaten bei jedem Versuch, die Probleme kurzfristig zu lösen, die Situation weiter verschlimmern. Überschuldung wird mit weiteren Schulden ‚bekämpft‘. Kurzfristige Verbesserungen werden mit mittel- bis längerfristig auftretenden großen weiteren Schäden erkauft.
Dass die Verschuldungsexzesse und Fehlallokationen irgendwann bereinigt werden müssen, liegt aber auf der Hand. Wenn Krisen aufgrund überbordender Schulden immer wieder mit neuen Schulden kurzfristig überspielt werden, wird das Problem nur in die Zukunft verlagert und dabei gleichzeitig ständig vergrößert – bis irgendwann auch neue Schulden und niedrigste Zinsen, bis hin zu Negativzinsen, selbst für eine kurzfristige Lösung nichts mehr nützen.
Für uns heute bedeutet das leider, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit keine einfache Lösung mehr geben wird und dass wir daher nur hoffen können, dass eine Regierung mit wirtschaftlichem Sachverstand die Weichen so in Richtung Freier Marktwirtschaft stellt, dass die Schäden möglichst gering gehalten werden und sich im Interesse der Menschen möglichst bald ein solider Aufschwung darstellen lässt, ein Wirtschaftswunder 2.0.
*“The rotten heart of Europe: The Dirty War for Europe’s Money”
Bernard Connolly, faber and faber, 2012, ISBN 978-0-571-30174-4
Autor: Markus Ross