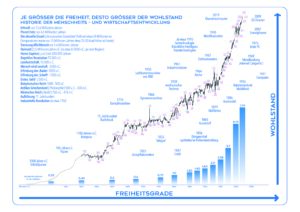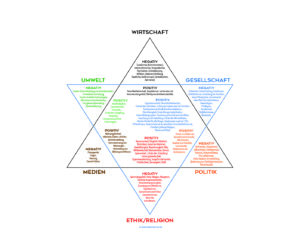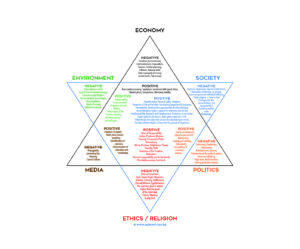„Zu den Irrtümern (der vorklassischen Schriftsteller), die in ihren direkten Folgen am verderblichsten waren, … gehörte die ungeheure Bedeutung, die man dem Konsum beimaß. Das große Ziel der Gesetzgebung im Bereich des nationalen Reichtums … war die Schaffung von Verbrauchern … Dieses Ziel wurde unter den verschiedenen Namen einer umfangreichen Nachfrage, einer lebhaften Berechnung, einer großen Geldausgabe und manchmal totidem verbis eines großen Verbrauchs als die große Bedingung des Wohlstands angesehen.
Beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist es nicht notwendig, diese Doktrin in ihrer absurdesten Form oder Anwendung zu bestreiten. Die Nützlichkeit einer großen Staatsausgabe zur Förderung der Industrie wird nicht mehr behauptet…
Im Gegensatz zu diesen offensichtlichen Absurditäten wurde von den politischen Ökonomen triumphierend festgestellt, dass der Konsum niemals der Ermutigung bedarf….Derjenige, der sein Einkommen spart, ist nicht weniger ein Konsument als derjenige, der es ausgibt: er konsumiert es auf eine andere Art und Weise; es liefert Nahrung und Kleidung, die von produktiven Arbeitern verbraucht werden, Werkzeuge und Materialien, die verwendet werden. Die Konsumtion findet also schon in dem Maße statt, wie es die Produktion zuläßt; aber von den beiden Arten der Konsumtion, der reproduktiven und der unproduktiven, trägt nur die erstere zum Volksvermögen bei, die letztere beeinträchtigt es. Was zum bloßen Genuß konsumiert wird, ist weg; was zur Reproduktion konsumiert wird, hinterläßt Waren von gleichem Wert, gewöhnlich mit dem Zusatz eines Gewinns. Die übliche Wirkung der Versuche der Regierung, den Konsum zu fördern, besteht lediglich darin, das Sparen zu verhindern, d. h. den unproduktiven Konsum auf Kosten des reproduktiven zu fördern und den nationalen Reichtum gerade durch die Mittel zu vermindern, die ihn vermehren sollten.
Was ein Land reicher machen soll, ist niemals der Konsum, sondern die Produktion. Wo letztere vorhanden ist, kann man sicher sein, dass es an ersterer nicht mangelt. Produzieren setzt voraus, dass der Produzent auch konsumieren will; warum sonst sollte er sich unnütze Arbeit machen? Er mag das, was er selbst produziert, nicht konsumieren wollen, aber sein Motiv für Produktion und Verkauf ist der Wunsch zu kaufen.
Wenn also die Produzenten im Allgemeinen immer mehr produzieren und verkaufen, kaufen sie natürlich auch immer mehr ein.
John Stuart Mill (Of the influence of consumption on production, 1830)
„Zu jeder Zeit kann ein sehr großer Teil des Kapitals brachliegen. Das Jahresprodukt eines Landes ist nie auch nur annähernd so groß, wie es sein könnte, wenn alle der Reproduktion gewidmeten Mittel, wenn also das gesamte Kapital des Landes voll beschäftigt wäre….
Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Perioden der „lebhaften Nachfrage“ auch die Perioden der höchsten Produktion sind: das nationale Kapital wird nur in diesen Perioden voll beschäftigt. Dies ist jedoch kein Grund, solche Zeiten zu wünschen; es ist nicht wünschenswert, dass das gesamte Kapital des Landes voll beschäftigt ist. Denn da die Berechnungen der Produzenten und Händler notwendigerweise unvollkommen sind, gibt es immer einige Waren, die mehr oder weniger im Überschuss sind, wie es immer einige gibt, die im Mangel sind. Wäre also die ganze Wahrheit bekannt, so würde es immer einige Klassen von Produzenten geben, die ihre Tätigkeit einschränken und nicht ausweiten. Wenn alle bestrebt sind, sie auszuweiten, ist das ein sicherer Beweis dafür, dass eine allgemeine Täuschung im Gange ist. Die häufigste Ursache einer solchen Täuschung ist ein allgemeiner oder sehr starker Anstieg der Preise (sei es durch Spekulation oder durch die Währung), der allen Händlern vorgaukelt, sie würden sich bereichern. Und so kommt es tatsächlich zu einer Steigerung der Produktion während des Prozesses der Wertminderung, solange die Existenz der Wertminderung nicht vermutet wird … Aber wenn die Täuschung verschwindet und die Wahrheit aufgedeckt wird, müssen diejenigen, deren Waren relativ im Überschuss sind, ihre Produktion verringern oder ruiniert werden: und wenn sie während der hohen Preise Mühlen gebaut und Maschinen errichtet haben, werden sie wahrscheinlich in der Freizeit bereuen.
John Stuart Mill (Of the influence of consumption on production, 1830)
„Unvernünftige Hoffnungen und unvernünftige Befürchtungen herrschen abwechselnd mit tyrannischer Gewalt über die Gemüter der Mehrheit des kaufmännischen Publikums; allgemeiner Kaufeifer und allgemeine Kaufzurückhaltung wechseln sich in kurzen Abständen mehr oder weniger deutlich ab. Abgesehen von kurzen Übergangszeiten herrscht fast immer entweder große Geschäftstätigkeit oder große Stagnation; entweder haben die Hauptproduzenten fast aller führenden Industrieartikel so viele Aufträge, wie sie ausführen können, oder die Händler fast aller Waren haben ihre Lager voll unverkaufter Waren.
In diesem letzten Fall spricht man gemeinhin von einem allgemeinen Überangebot; Und da diejenigen Ökonomen, die die Möglichkeit eines allgemeinen Überflusses bestritten haben, weder die Möglichkeit noch das häufige Auftreten der soeben festgestellten Erscheinung leugnen, so scheint es ihnen obzuliegen, zu zeigen, dass der Ausdruck, gegen den sie Einspruch erheben, nicht auf einen Zustand anwendbar ist, in dem alle oder die meisten Waren unverkauft bleiben, und zwar in demselben Sinne, in dem man von einem Überfluss an irgendeiner Ware spricht, wenn sie mangels eines Marktes in den Lagern der Händler bleibt.“
John Stuart Mill (Of the influence of consumption on production, 1830)
„Wer eine Ware zum Verkauf anbietet, will im Austausch dafür eine Ware erhalten und ist daher allein dadurch, dass er ein Verkäufer ist, ein Käufer. Die Verkäufer und die Käufer aller Waren zusammengenommen müssen durch die metaphysische Notwendigkeit des Falles ein genaues Äquivalent zueinander sein; und wenn es mehr Verkäufer als Käufer für eine Sache gibt, muss es mehr Käufer als Verkäufer für eine andere geben.
Dieses Argument beruht offensichtlich auf der Annahme eines Tauschzustandes; und unter dieser Annahme ist es vollkommen unanfechtbar. Wenn zwei Personen einen Tauschakt vollziehen, ist jeder von ihnen zugleich Verkäufer und Käufer. Er kann nicht verkaufen, ohne zu kaufen. Wenn er sich nicht entscheidet, die Ware eines anderen zu kaufen, verkauft er seine eigene nicht.
Nimmt man jedoch an, dass Geld verwendet wird, so sind diese Sätze nicht mehr ganz richtig… Der Austausch mittels Geld ist also, wie schon oft bemerkt wurde, letztlich nichts anderes als Tauschhandel. Aber mit dem Unterschied, dass beim Tauschhandel Verkaufen und Kaufen gleichzeitig in einem Vorgang vereint sind; man verkauft, was man hat, und kauft, was man will, in einem unteilbaren Akt, und man kann das eine nicht tun, ohne das andere zu tun. Die Wirkung und sogar der Nutzen des Geldes besteht nun darin, dass es diesen einen Akt des Austausches in zwei getrennte Handlungen oder Operationen aufteilt, von denen die eine jetzt und die andere in einem Jahr oder wann immer es am günstigsten ist, durchgeführt werden kann. Obwohl derjenige, der verkauft, in Wirklichkeit nur verkauft, um zu kaufen, braucht er nicht im selben Augenblick zu kaufen, in dem er verkauft; und er erhöht daher nicht notwendigerweise die unmittelbare Nachfrage nach einer Ware, wenn er das Angebot einer anderen erhöht. Da nun Kauf und Verkauf getrennt sind, kann es durchaus vorkommen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine sehr allgemeine Neigung besteht, so schnell wie möglich zu verkaufen, begleitet von einer ebenso allgemeinen Neigung, alle Käufe so lange wie möglich aufzuschieben. Dies ist immer tatsächlich der Fall in den Perioden, die als Perioden des allgemeinen Überschusses bezeichnet werden. Und niemand wird nach ausreichender Erklärung die Möglichkeit eines allgemeinen Exzesses in diesem Sinne des Wortes bestreiten. Der Zustand, den wir soeben beschrieben haben, und der nicht selten vorkommt, läuft darauf hinaus.
Denn wenn es eine allgemeine Angst zu verkaufen, und eine allgemeine Abneigung zu kaufen, Waren aller Art bleiben für eine lange Zeit unverkauft, und diejenigen, die einen sofortigen Markt zu finden, tun dies zu einem sehr niedrigen Preis … Es ist Stagnation für diejenigen, die nicht verpflichtet sind, zu verkaufen, und Not für diejenigen, die sind …
Um das Argument der Unmöglichkeit eines Überschusses an allen Waren auf den Fall anzuwenden, in dem ein zirkulierendes Medium verwendet wird, muss das Geld selbst als eine Ware betrachtet werden. Zweifellos muss man zugeben, dass es nicht gleichzeitig einen Überschuss an allen anderen Waren und einen Überschuss an Geld geben kann.
Aber diejenigen, die in den von uns beschriebenen Zeiten einen Überschuss an allen Waren behauptet haben, haben nie behauptet, dass das Geld eine dieser Waren sei; sie waren der Meinung, dass es keinen Überschuss, sondern einen Mangel an dem zirkulierenden Medium gab. Was sie einen allgemeinen Überfluß nannten, war nicht ein Überfluß an Waren im Verhältnis zu den Waren, sondern ein Überfluß an allen Waren im Verhältnis zum Geld.“
John Stuart Mill (Of the influence of consumption on production, 1830)
„Das Argument gegen die Möglichkeit einer allgemeinen Überproduktion ist ziemlich schlüssig, soweit es sich auf die Doktrin bezieht, dass ein Land zu schnell Kapital akkumulieren kann; dass die Produktion im Allgemeinen, indem sie schneller wächst als die Nachfrage danach, alle Produzenten in Bedrängnis bringen kann. Diese Behauptung war seltsamerweise noch vor dreißig Jahren fast eine anerkannte Lehre; und das Verdienst derjenigen, die sie entlarvt haben, ist viel größer, als man aus der extremen Offensichtlichkeit ihrer Absurdität schließen könnte, wenn man sie in ihrer ursprünglichen Einfachheit darlegt. Es ist wahr, dass, wenn alle Bedürfnisse aller Einwohner eines Landes vollständig befriedigt wären, kein weiteres Kapital eine nützliche Beschäftigung finden könnte; aber in diesem Fall würde keines angehäuft werden. Solange es noch Menschen gibt, die nicht im Besitz des Lebensunterhalts, sondern der feinsten Luxusgüter sind, und die arbeiten würden, um sie zu besitzen, gibt es Beschäftigung für das Kapital…
Nichts kann chimärischer sein als die Befürchtung, dass die Anhäufung des Kapitals Armut und nicht Reichtum hervorbringt, oder dass sie jemals zu schnell für ihren eigenen Zweck erfolgen wird. Nichts ist wahrer als die Tatsache, dass die Beschaffung den Markt für die Produkte bildet, und dass jede Steigerung der Produktion, wenn sie ohne Fehlberechnung auf alle Arten von Produkten in dem Verhältnis verteilt wird, das das Privatinteresse diktieren würde, ihre eigene Nachfrage schafft, oder vielmehr bildet.
Dies ist die Wahrheit, die die Leugner der allgemeinen Überproduktion ergriffen und durchgesetzt haben…“
John Stuart Mill (Of the influence of consumption on production, 1830)
„Das Wesentliche der Lehre bleibt erhalten, wenn man zugesteht, dass es keinen dauerhaften Überschuss der Produktion oder der Akkumulation geben kann; obwohl man gleichzeitig zugibt, dass es einen vorübergehenden Überschuss eines einzelnen Artikels geben kann, wenn man ihn gesondert betrachtet, so auch bei den Waren im Allgemeinen, nicht als Folge einer Überproduktion, sondern eines Mangels an kommerziellem Vertrauen.“
John Stuart Mill (Über den Einfluss des Konsums auf die Produktion, 1830)