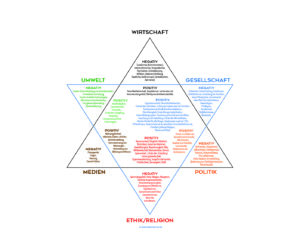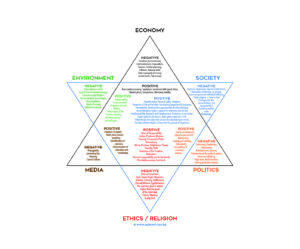Markus Ross11.09.2020Wirtschaft
Wie funktioniert unsere Wirtschaft und woher kommt unser Wohlstand? Diesen Fragen geht Markus Ross in einer Artikelserie nach, die einen tieferen Einblick in die Geschichte der Wirtschaft gibt und die den großen Fragen der Ökonomie auf den Grund geht.
“Die Kunst der Wirtschaftswissenschaften besteht darin, nicht nur die kurzfristigen Folgen, sondern vor allen Dingen die längerfristigen Wirkungen einer Maßnahme oder Vorgehensweise zu beachten, sie besteht auch darin, die Wirkungen der Maßnahmen nicht nur auf eine Interessengruppe, sondern auf alle Gruppen zu berücksichtigen.“
Henry Hazlitt
Markt und Arbeitsteilung
Wir betrachten nachfolgend einige Segmente des ökonomischen menschlichen Handels genauer, um die wirtschaftlichen Zusammenhänge besser verstehen zu können und Lösungsansätze zu entwickeln zur Bewältigung und zur Vermeidung von Krisen.
Schon in der Kleinfamilie beziehungsweise der Kleingruppe der Jäger- und Sammlerzeit kam es zu Arbeitsteilung, da ein Mensch allein aus eigener Kraft kaum in der Lage ist, alle seine Bedürfnisse zu befriedigen. Der eine jagte, der andere sammelte Beeren, wieder andere kümmerten sich um die Familie und andere Dinge – es wurden mithin ‚Waren‘ und ‚Leistungen‘ getauscht. Die Tauschbeziehung gilt insofern als die grundlegendste Form sozialen Austauschs. Sie findet, wie bereits eingangs erwähnt, an einem wie auch immer gearteten ‚Markt‘ statt, an dem Güter und Leistungen entweder direkt gegeneinander getauscht werden oder über den Umweg von ‚Geld‘. Märkte können lokal, regional oder international sein. Silber- und Goldmünzen wurden zum Beispiel schon immer über Landesgrenzen hinweg akzeptiert als werthaltiges, allseits gültiges Zahlungsmittel.
Der Markt ist der Dreh- und Angelpunkt allen wirtschaftlichen Handelns, zu dem im zeitlichen Ablauf Produktion, Vertrieb beziehungsweise Verteilung und Konsum gehören.
Bei einem Tausch am Markt werden letztlich immer Güter und Leistungen gegeneinander getauscht, wenn auch heute in der Regel über den Umweg über Geld, das ‚zwischengeschaltet‘ wird, um die Abwicklung zu erleichtern.
Auf einem Markt wird immer ‚Positiver Nutzen‘ (Vorteile) gegen ‚Negativen Nutzen‘ (Nachteile) getauscht. Man erhält eine Ware (Vorteil) im Tausch gegen ein anderes Gut (Nachteil), das man weg gibt. Das kann auch Geld sein.
Beim Arbeiten tauscht man Freizeit gegen Lohn, der in Geld ausbezahlt wird. Dieses Geld benutzt man dann um die Miete zu bezahlen (das Gut ‚Wohnen‘), Essen, Kleidung, Auto, Konsumgüter. Das sind alles Dinge, die einen ‚Wert‘ haben, sogenannte ‚ökonomische Güter‘, die nicht frei erhältlich sind, wie zum Beispiel Luft oder Meerwasser. Was die einzelnen Güter und Dienstleistungen wert sind, hängt von den subjektiven Empfindungen und Entscheidungen der Marktteilnehmer ab, die sich letztlich bei einem ‚Marktpreis‘ zusammenfinden. Es gibt keinen dauerhaft festen Wert von Gütern und Leistungen. Alles ist im Fluss. Wenn sich der Geschmack der Leute ändert oder es technologische Neuerungen gibt, verlieren einstmals begehrte Güter schnell an Wert. Seitdem es Smartphones gibt, interessiert sich kaum noch jemand für andere Mobiltelefone, DVDs waren der Untergang der Videokassetten, CDs brachten die Nachfrage nach Schallplatten fast komplett zum Erliegen.
In der Wüste auf der anderen Seite würde ein Verdurstender einem anderen für einen Schluck Wasser Millionen in Diamanten geben.
Wie bereits oben erwähnt, beschäftigte sich schon im Alten Griechenland der berühmte Philosoph und Naturforscher Aristoteles (385 – 383 vor Christus) mit dem Wert von Gütern und unterschied zum Beispiel den ‚Gebrauchswert‘ vom ‚Tauschwert‘. Der Gebrauchswert einer Sache beschreibt den Nutzwert für einen Anwender, also zum Beispiel einer Nadel für eine Näherin oder von Hammer und Säge für einen Schreiner; der Tauschwert dagegen ist das, was man für ein bestimmtes Gut zu einem bestimmten Zeitpunkt als Gegenwert erhält. Beide Werte ändern sich über die Zeit, für eine wirtschaftliche Betrachtung ist aber an sich nur der Tauschwert relevant. Untauglich für eine realistische Bewertung von Gütern ist zum Beispiel die Frage, wie viel Arbeit erforderlich ist, um ein bestimmtes Gut zu produzieren oder wie viel Arbeit der Einsatz dieses Gutes dem Anwender erspart.
Als „Gut“ definiert man etwas, das knapp ist, das in Besitz genommen werden kann, das zum Erreichen eines Ziels eingesetzt werden kann und einen Wert hat.
Kein ‚Gut‘ in diesem Sinne sind z.B. die Luft in der Umwelt, Regenwasser, Meerwasser.
Man unterscheidet auch zwischen ‚privaten Gütern‘ und ‚öffentlichen Gütern‘. Ein öffentliches Gut ist zum Beispiel ein ‚Leuchtturm‘, den jeder Kapitän eines vorbeifahrenden Schiffs nutzen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. Nicht jedes ‚öffentliche‘ Gut muss allerdings zwingend vom Staat bereitgestellt werden müsste; private ‚Gönner‘ und Philanthropen könnten dazu durchaus auch bereit sein.
„Ein Ding wird zum Mittel, indem menschliches Denken es zur Erreichung eines Zweckes einzusetzen plant und menschliches Handeln es zur Erreichung eines Zweckes einsetzt.“
Ludwig von Mises
Wenn der Preis, der Wert, eines Gutes, von einer Regierung willkürlich festgesetzt wird (abweichend vom dem Preis, der sich über Angebot und Nachfrage ‚am Markt‘ bilden würde), kommt es zu erheblichen Fehlentwicklungen: wenn der Staat, das heißt die Regierung oder Planungsbehörde, die Preise zu niedrig ansetzt, kaufen die Konsumenten möglichst viel davon und mehr als sie normalerweise benötigen, was schnell dazu führt, dass die Regale ausgeräumt sind und einige Menschen leer ausgehen. Wenn die Preise zu hoch angesetzt werden, weichen die Kunden wenn möglich auf andere vergleichbare Waren aus; die zu teure Ware bleibt ungenutzt liegen, Kapital, das an anderer Stelle benötigt wird, bleibt ungenutzt.
(es gab zum Beispiel mal die Situation, dass eine Regierung die Preise für Brot so niedrig ansetzte, dass die Menschen das Brot kauften und an ihre Tiere verfütterten, eine riesige Verschwendung von Ressourcen).
Staatliche Eingriffe in die Preisentwicklung – seien es Mindestlöhne, Mietpreisdeckelung oder Höchstpreise für Waren – führen in der Regel bald zu Ausweichbewegungen. Wenn Preise zu niedrig angesetzt werden, werden Produzenten die entsprechenden Waren nicht mehr zu diesen Preisen anbieten, es entstehen ‚Schwarzmärkte‘, an denen die Preisvorgaben umgangen werden. Auch wenn der Staat in die Preise zu stark mittels Steuern und Abgaben eingrifft, kommt es zu entsprechenden Ausweichbewegungen. Im Bereich der Löhne zum Beispiel kommt es dann vermehrt zu Schwarzarbeit, es entsteht eine ‚Schattenwirtschaft‘. Die Realität lässt sich eben nicht unbegrenzt ‚verbiegen‘, die Menschen suchen immer nach Ventilen für ihre Frustration oder zur Abwehr von Maßnahmen, die sie für unbillig halten.
Wer die Wirtschaft versklavt und reglementiert, versklavt letztlich die Menschen. Wenn die Produktion und der Handel in den Händen der Regierung liegt und die Bürokraten über alle Zuteilungen von Waren entscheiden, herrscht eine ökonomische Diktatur.
Ein freier Markt, in dem nur Angebot und Nachfrage freier Wirtschaftssubjekte zählt, bestätigt dagegen die Souveränität der Bevölkerung und gilt somit als einer der wichtigsten Bausteine einer Gesellschaftsform zum Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bürger.
Der Unternehmer und die Produktion
Der Konsument ist am freien Markt zwar souverän in seiner Kaufentscheidung und seine subjektive Wertzumessung ist bei der Preisbildung ein wesentlicher Faktor. Die wichtigste Funktion hat in einer freien Wirtschaft jedoch der Unternehmer, der die Güter bereitstellt, von denen er glaubt, dass sie am Markt zu Preisen nachgefragt werden, die ihm bei einem Verkauf einen Gewinn versprechen. Nur was vorher produziert wurde, steht für den Konsum und zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung.
Der Unternehmer muss überlegen und abschätzen, welche Güter von den Konsumenten am Markt zu welchen Preisen nachgefragt werden und welche dieser Güter er produzieren soll und kann. Dazu muss er berechnen, mit welchen Techniken und mit welchen Rohstoffen und unter Einsatz von welcher Menge an Arbeitszeit und zu welchen Gesamtkosten er die Güter produzieren kann, weiterhin wie und mit welchem Aufwand er die Güter an die Verkaufsstellen transportieren kann. Diese erwarteten Gesamtkosten muss er abgleichen mit dem zu erwartenden Verkaufserlös. Es handelt sich in allen Bereichen um ‚Erwartungen‘, da sich alles in der Zukunft abspielt und insofern Unsicherheit besteht – und damit einhergehend um Risiken.
„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“
Mark Twain
Viele Unternehmer treffen die falschen Entscheidungen und gehen pleite, oder haben schlichtweg Pech, wie zum Beispiel beim Auftreten sogenannter „Schwarzer Schwäne“. So nennt man außergewöhnliche Ereignisse, die die Welt schlagartig verändern – wie im Jahr 2020 die Corona-Krise und der mit ihr verbundene Lockdown, der zum Beispiel ein großes und lange Jahre erfolgreiches Unternehmen wie die Lufthansa von einem auf den anderen Tag an den Rand des Ruins getrieben hat.
Um ein eigenes Unternehmen erfolgreich aufzubauen, zu führen und langfristig am Leben zu erhalten, muss der Unternehmer über das notwendige ‚Handwerkszeug‘ verfügen, wirtschaftliche Kenntnisse haben, über viel Erfahrung in seiner Branche verfügen, den Markt ständig beobachten, die Zukunft richtig einschätzen – und darauf basierend die Weichen in seiner Firma überwiegend richtig stellen.
Zu den notwendigen Kenntnissen gehören auch wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel das ‚Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen‘, das besagt, dass der Wert einer Sache von der Knappheit eines Gutes in Relation zur Nachfrage abhängt. Um bei dem Beispiel vom Wasser in der Wüste zu bleiben: wenn ein ganzer Tankwagen durch die Wüste rollt und Wasser nicht knapp ist, wird keiner Millionen für einen Schluck Wasser bezahlen. Und das zehnte Auto gleichzeitig bringt im Vergleich zum ersten Auto nur noch wenig zusätzlichen Nutzen für eine Familie.
Ein weiteres Gesetz ist Ricardos ‚Gesetz der komparativen Kosten‘, das besagt, dass es für ein Land sinnvoll ist, primär die Güter zu produzieren, bei denen es die vergleichsweise kleinsten Produktionskostennachteile hat beziehungsweise die größten komparativen Kostenvorteile. Der positive Wohlstandseffekt des Außenhandels liegt darin, dass andere Länder bestimmte Waren vergleichsweise günstiger produzieren können. Selbst wenn ein Land ALLE Güter günstiger produzieren kann als ein anderes Land, ist es sinnvoll, dass das teurer produzierende Land vor allen Dingen die Güter produziert, bei denen es die geringsten Nachteile hat und diese dann in das andere Land exportiert, das sich aus der Produktion dieser Güter mehr und mehr zurückzieht. Dieses Gesetz ist ein wesentliches Argument für den freien Handel in der Welt. Vom freien Welthandel profitieren alle – so lange er zu fairen Bedingungen abläuft.
Auch das ‚Gesetz abnehmender Renditen‘ oder „Ertragsgesetz“ ist wichtig. Es besagt, dass ab einem bestimmten Punkt der zusätzliche Einsatz eines Produktionsfaktors keinen oder nur noch einen geringen positiven Effekt hat, wenn nicht gleichzeitig auch der Einsatz aller anderen Produktionsfaktoren im gleichen Verhältnis gesteigert werden kann. Das kann zum Beispiel zusätzlicher Dünger auf einem Feld sein oder mehr Arbeitskräfte, die an einer bestimmten Anzahl von Maschinen arbeiten.
Ein Unternehmer kann nur wirtschaftlich überleben, wenn er Gewinne macht. Um das unternehmerische Risiko der Verluste zu rechtfertigen im Vergleich zu einer risikolosen Anstellung bei einer anderen Firma, muss der erwartete Gewinn oder Unternehmerlohn deutlich höher sein als das Gehalt bei einer risikolosen Festanstellung. Oft genug und vor allen Dingen in der Summe über alle Unternehmen eines Landes ist das jedoch nicht der Fall.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass angestellte Vorstände und Geschäftsführer von großen Unternehmen KEINE Unternehmer sind, selbst nur wenige Risiken tragen – und heutzutage dennoch oftmals fürstlich entlohnt werden.
Der ganze ökonomische Prozess dreht sich letztlich um das Thema Produktion. Wenn die Produktion in der Hand privater Unternehmer liegt, können diese große Gewinne machen – wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen und keine großen Krisen oder unerwartete Ereignisse ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn sie aber Fehlentscheidungen treffen oder Pech haben, werden sie schnell zum Opfer und verlieren ihr Geld. Der Gewinn ist die Entschädigung für das hohe Risiko, das der Unternehmer trägt.
Der Konsument auf der anderen Seite trägt keine Risiken und verliert nicht, wenn der Unternehmer verliert.
Eine Ware entsteht im Rahmen eines Produktionsprozesses unter Einsatz von Arbeitszeit, Rohmaterialien, Maschinen und Technologie. Der Produktionsprozess ist ein ‚negativer Nutzen‘ bezogen auf die geistige und körperliche Anstrengung, die in die Produktion der Ware einfließt und bezüglich des Einsatzes von Kapital für die Maschinen und zum Beispiel auch deren Abnutzung. Beim Produktionsprozess wird eine Idee in die Tat umgesetzt, ein Ziel realisiert: nämlich die Erstellung einer Ware. Der Produzent bezahlt für Arbeit und Kapital und erhält am Ende eines erfolgreichen Produktionsprozesses die Ware, die er dann am Markt verkaufen kann. Der erhoffte Gewinn beim Verkauf der Ware ist die Vergütung des Unternehmers und die Kompensation für das hohe Risiko, das der Unternehmer eingeht.
Die Produktion einer Ware oder einer Dienstleistung ist ein kreativer Schöpfungs- und Gestaltungsprozess. Der Unternehmer setzte eine Idee beziehungsweise einen Plan in die Realität um. Das Ziel ist die Erschaffung eines Produkts oder einer Dienstleistung.
‚Zeit ist Geld‘ sagt man. Für einen Unternehmer ist der Zeitfaktor äußerst wichtig. Produktion ist insofern ein Wettlauf mit der Zeit als in dem Produktionsprozess viel Kapital gebunden ist, das finanziert und zurückgezahlt werden muss. Eine Investition in Maschinen und Gebäude rechnet sich in der Regel nur, wenn alle Maschinen über den geplanten Amortisationszeitraum im Einsatz sind und nicht neue Technologien die Planung über den Haufen werfen. Weiterhin besteht das Risiko, dass sich über die Zeit der Geschmack der Konsumenten ändert, neue Produktionstechniken es den Wettbewerbern ermöglichen, die Waren viel günstiger zu produzieren oder bestimmte wichtige Rohstoffe nicht mehr verfügbar sind oder nur zu viel höheren Preisen als kalkuliert.
Wie wir auch an dieser Stelle sehen, sind die Marktpreise ein entscheidender Faktor für Erfolg und Misserfolg.
Unternehmerisches Risiko ist unvermeidbar, da sich die Zukunft auch mit den ausgefeiltesten Computermodellen nicht berechnen lässt. Das gilt sowohl für den privaten Unternehmer als auch für staatliche Zentralplanungsbehörden. Was ein erfahrener Unternehmer nicht absehen kann, kann auch keine staatliche Planungsbehörde vorhersehen. Wenn bei einer Planwirtschaft der Staat das unternehmerische Risiko trägt, geht dies im Zweifelsfall zu Lasten der Bürger und Steuerzahler. Die Ergebnisse der Zentralplanung in der Sowjetunion und der DDR belegen das zweifelsfrei.
(Die Millionen von Seiten Papier, die für die Planung bedruckt werden und die von einem Heer von Bürokraten zusammengestellt werden, haben sich in aller Regel als vollkommen nutzlos erwiesen).
Sparen und Investieren
Die Ersparnis ist der Schlüssel zu einem gesunden Wirtschaftswachstum und zu einer Erhöhung der zukünftigen Güterproduktion. Ersparnis ist der Teil der Produktion, der nicht konsumiert wird und für Investitionen zur Verfügung steht. Investitionen in Fabriken, Maschinen, Häuser, in die Anstellung zusätzlicher Arbeiter, mit dem Ziel der Erhöhung der Produktion. Erhöhte Produktion, das heißt ein höheres Güterangebot, wird tendenziell zu einer Senkung der Lebenshaltungskosten führen (unter normalen Umständen und einem gesunden Geldsystem tendieren die Preise insofern dazu, zu fallen). Das Geld, das investiert wird, kann bei einem nicht manipulierten Geldsystem nur aus der Ersparnis an anderer Stelle kommen. Ein Sparer will mit dem ersparten Geld normalerweise eine Rendite erwirtschaften (Zinsen, Immobilien, Aktien, Anleihen…) und wird es nicht unter der Matratze horten. Das ersparte Geld steht über Banken oder den Kapitalmarkt (Aktien, Anleihen) Unternehmern zur Finanzierung oder Ausweitung ihrer produktiven Unternehmungen zur Verfügung.
Ersparnis und Investition sind zwei Seiten derselben Medaille und die wesentlichen Faktoren, die in der Zukunft eine Ausweitung der Produktion, ein erhöhtes Güterangebot, mehr Arbeitsplätze und ein Sinken der Güterpreise ermöglichen.
Die Auflösung von Ersparnissen für Konsumausgaben hingegen führt dazu, dass die Produktion stagniert, der Kapitalstock aufgebraucht wird und die Preise steigen. Dadurch sinkt die Kaufkraft der breiten Masse, die Wirtschaft schwächelt und es kommt zu Massenarbeitslosigkeit.
Gemäß Keynes haben staatliche Investitionen dieselbe positive Wirkung wie Investitionen privater Unternehmer. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass bei staatlichen Unternehmungen horrende Summen verschleudert werden. Private Unternehmer treffen selbstverständlich auch gelegentlich Fehlentscheidungen, aber prozentual deutlich weniger und meistens auch mit weniger Geld. Mit ‚OPM‘ (Other People’s Money) wird eben immer liederlicher umgegangen als mit dem eigenen.
Es ist erwiesen, dass Unternehmer eine bessere Einschätzung der zukünftigen Entwicklung und Investitionsmöglichkeiten haben als Ökonomen und schon gar staatliche Bürokraten. Die Frage, wer der bessere Unternehmer ist, der zentralplanerische Staat oder der freie Unternehmer, wird seit hunderten von Jahren jeden Tag aufs Neue beantwortet: die Privaten.
Die ‚Klassiker‘ und die ‚Österreicher‘ haben die wichtige Funktion der Ersparnis für das Wachstum der Wirtschaft erkannt.
Die Anhänger des Keynesianismus halten jedoch nichts vom Sparen, sondern möchten, dass möglichst viel Geld ausgegeben wird.
Kapital
Kapital entsteht durch Ersparnis, das heißt echtem Konsumverzicht, und Investitionen. Diese bilden Schritt für Schritt den ‚Kapitalstock‘ eines Landes, die Produktionskapazitäten. Je besser diese Kapazitäten ausgestattet sind und je mehr es davon gibt, desto mehr kann ein Land mit einer bestimmten Zahl von Arbeitskräften an Gütern und Leistungen produzieren.
Zur Umsetzung seiner Pläne benötigt der Unternehmer einerseits Ideen und Mut, vor allem aber Kapital. Mit dem Kapital, das entweder aus eigenen Quellen stammt oder von einem Kapitalgeber bereitgestellt wird, finanziert er die Maschinen, Büros, Fabriken, Rohmaterialien und die Arbeitskräfte, die er zur Produktion benötigt. Der Unternehmer und der Kapitalgeber teilen sich das unternehmerische Verlustrisiko. Als Lohn für die Übernahme des Risikos erhält der Kapitalgeber entweder Zinsen oder Dividenden und der Unternehmer erhält im Erfolgsfall seinen Unternehmerlohn, der zum Teil auch aus Dividenden bestehen kann.
Arbeitsmarkt und Löhne
Der zweite Produktionsfaktor neben dem Kapital ist die Arbeit.
Beim Thema Arbeitsmarkt geht es in den unterschiedlichen Wirtschaftstheorien vorrangig um das Thema Arbeitslosigkeit, wie diese zu erklären ist und welches die richtigen Schritte sind, um Arbeitslosigkeit zu beseitigen. (Unfreiwillige) Arbeitslosigkeit ist zum einen eine riesige Ressourcenverschwendung und zum anderen auch sozial und menschlich sehr kritisch. Insofern ist das Ziel ‚Vollbeschäftigung‘ grundsätzlich durchaus sinnvoll (man sollte es nur nicht ‚zu jedem Preis‘ anstreben).
Die Klassiker gehen davon aus, dass sich an einem freien Markt die Löhne, der Preis der Arbeit bzw. die Vergütung für den Verzicht auf Freizeit, auch über Angebot und Nachfrage zu einem ‚Gleichgewichtspreis‘ herausbilden, an dem Vollbeschäftigung herrscht. Die ‚unsichtbare Hand‘ des Wettbewerbs würde zu optimalen Allokationsergebnissen führen und Angebot und Nachfrage bei einem optimalen Lohn ins Gleichgewicht bringen.
Hier stellt sich aber leider das Problem, dass der Arbeitsmarkt in den wenigsten Ländern ‚frei‘ ist. Über Mindestlöhne, Tarifverträge u.v.a.m. greift der Staat in die Preisbildung ein, die Marktteilnehmer können insofern nicht frei über die Löhne entscheiden. Darüber hinaus verteuert der Staat die Löhne noch in erheblichem Maß über Sozialabgaben und Auflagen. Fakt ist, dass die Löhne heutzutage kaum sinken können, auch wenn Arbeitslose bereit wären, zu niedrigeren Löhnen zu arbeiten. Das ist aber kein Fehler des Marktes oder der klassischen oder liberalen Theorie und bedeutet nicht, dass die Annahme falsch ist, dass der Arbeitsmarkt über Lohnanpassungen zu einem Vollbeschäftigungsgleichgewicht tendieren würde.
Das freie Spiel der Kräfte würde auch nicht unbedingt bedeuten, dass es den ‚mächtigen‘ Arbeitgebern gelänge, die Löhne immer weiter zu drücken. Gerade heute in Zeiten von Internet und Transparenz können Arbeitnehmer leicht feststellen, welche Löhne in bestimmten Branchen oder Regionen bezahlt werden – und können den Arbeitsplatz wechseln, wenn der eigene Arbeitgeber weniger bezahlt. Und auch die Existenz von Arbeitnehmervereinigungen, Gewerkschaften, wird dafür sorgen, dass Arbeitnehmerrechte nicht unterdrückt werden.
An dem Punkt Arbeitslosigkeit aufgrund starrer Löhne setzt die ‚keynesianische‘ Theorie an. Keynes erkannte bei dem Wirtschaftseinbruch nach dem Ersten Weltkrieg, dass es kaum gelingen würde, die Löhne gegen die Macht der Gewerkschaften zu senken. Das wäre aber erforderlich gewesen, um vielen der Arbeitslosen wieder zu einer Beschäftigung zu verhelfen. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch und da es damals noch nicht so viele Versicherungen und Schutzschirme gab, war das wirtschaftlich für viele Familien sehr schlimm. Keynes wollte die Gewerkschaften dadurch ‚austricksen‘, dass er über Inflation, das heißt Geldentwertung, die Reallöhne absenkt – bei ansonsten gleichen Nominallöhnen. Und darauf mehr oder weniger baut letztlich seine ganze Wirtschaftstheorie auf. Argumentativ geht er so vor, dass er als Ursache der Arbeitslosigkeit hauptsächlich eine mangelnde Nachfrage nach Gütern sieht, aufgrund derer die Produzenten weniger produzieren würden und deshalb Arbeiter entlassen würden.
Die Lösung läge darin, die Nachfrage zu erhöhen. Und das am besten über den Staat, der sich dafür verschulden würde und / oder ‚Geld druckt‘. Die zusätzliche staatliche Nachfrage würde dann über Multiplikatoreffekte zu weiteren Steigerungen des Sozialprodukts, der Wirtschaftsleistung, führen, verbunden mit weiterer Nachfrage nach Arbeitskräften. Man könne letztlich über Geldentwertung Arbeitsplätze schaffen.
Leider besteht aber die große Gefahr, dass zwar die erwartete Inflation eintritt, aber langfristig keine zusätzlichen Arbeitsplätze entstehen – das nennt man dann ‚Stagflation‘.
Löhne hängen nicht nur von den ökonomischen Verhältnissen in einem Land ab, sondern vom internationalen Wettbewerb. Der internationale Wettbewerb bestimmt die Preise von Rohstoffen und Gütern am Weltmarkt. Und ‚Arbeit‘ ist eine Ware, ein Gut. Der Lohn ist der Preis für den ‚negativen‘ Nutzen „Arbeit“, die Entschädigung für die Aufgabe von Freizeit. Was nur zum Spaß gemacht wird, gilt ökonomisch nicht als „Arbeit“.
Dem Weltmarkt kann sich keine Nation entziehen, die am Welthandel teilnehmen möchte und nicht autark ist. Die Preise am Weltmarkt bestimmen sowohl die Vergütung des Unternehmers sowie diejenige des Arbeiters. Arbeiter können sich grundsätzlich aussuchen, in welchem Land sie arbeiten möchten, und insofern beeinflussen die Weltmarktpreise auch die heimischen Löhne.
Dass die Löhne in den letzten drei Jahrzehnten in den westlichen Ländern tendenziell gefallen sind oder zumindest nicht gestiegen sind, liegt vor allen Dingen an der Globalisierung und in diesem Zusammenhang an der Tatsache, dass aus Asien und Osteuropa eine sehr große Zahl an zusätzlichen Arbeitskräften auf den globalen Arbeitsmarkt gekommen sind – was die Preise gedrückt und durchaus zu einem starken Missverhältnis der Entwicklung von Lohn- und Kapitaleinkünften geführt hat. Diese Entwicklung wird sich jedoch vermutlich bald umkehren.
Erklärungsansätze, die die Höhe der Löhne davon abhängig machen wollen, wie viel ein Arbeiter an Geld benötigt, um seine Arbeitskraft zu erhalten oder ein ‚Existenzminimum‘ zu bestreiten, sind nicht fundiert. Genau so wenig wie die angebliche Abhängigkeit der Löhne von dem Volumen eines von den Unternehmern gespeisten ‚Lohnfonds’ oder von den Kosten der Ausbildung eines Arbeiters. Was zählt sind die Qualifikationen der Arbeiter sowie Angebot und Nachfrage nach diesen Qualifikationen.
Löhne werden auch nicht unbedingt aus dem ‚Kapital‘ der Unternehmen bezahlt, denn letztlich bezahlt der Konsument die Arbeit insofern als die Kosten der Arbeit in die Preisgestaltung der Waren einfließt. Nur wenn ein Produkt nicht verkauft werden kann, gehen die Kosten zu Lasten des Kapitals des Produzenten. Die Arbeitskosten fließen zwar in die Kalkulation des Unternehmers ein, aber der Wert einer Ware am Markt richtet sich nicht primär danach, wie viel Arbeit in ihr steckt (Arbeitswerttheorie). Wenn ein anderer Produzent ein gleichartiges Produkt mit einer besseren Technologie und besseren Maschinen mit der Hälfte des Arbeitsaufwandes und der Hälfte der Arbeitskosten entsprechend günstiger am Markt anbieten kann, wird der teurere Produzent seine Preise absenken müssen, oder er bleibt auf der Ware hängen. Der Konsument wird nicht mehr bezahlen, nur weil der teurere Produzent mehr Arbeit investiert hat.
Arbeitslosigkeit
So lange die Produktionsmethoden noch primitiv waren und es keine Maschinen gab, die dem Menschen die Arbeit erleichterten oder ganz abnahmen, gab es keine Arbeitslosigkeit. Das bedeutete aber keinesfalls, dass es den Menschen gut ging. Die Zeit vor der Industriellen Revolution prägte ein großes Elend. Der Grund hierfür liegt in der geringen Produktivität der damaligen Produktionsmethoden. Es gab damals sogar insofern einen Mangel an Arbeitskräften, als nicht genug produziert werden konnte, um die grundlegendsten Bedürfnisse aller zu befriedigen. Auch Kinder mussten auf den Feldern mitarbeiten, um der Familie das Überleben zu sichern. Bis zum Beginn der Industriellen Revolution (etwa 1800) waren die allermeisten Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, nur um das primäre Bedürfnis nach Nahrung zu befriedigen. Wobei auch das oftmals nicht gelang, und immer wieder viele Menschen verhungerten. Zwischen 80 und 90 Prozent der Menschen arbeiteten damals auch in den westlichen Ländern in der Landwirtschaft.
Die Industrielle Revolution änderte dieses Bild schlagartig. In Bezug auf die Landwirtschaft kam es zur ‚Zweiten Landwirtschaftlichen Revolution‘. Viele Landarbeiter verloren über den Einsatz von Maschinen ihren Arbeit und zogen in die Städte, wo sie als Industriearbeiter tätig wurden. Die Arbeitsbedingungen waren in der ersten Zeit ziemlich übel, das Leben schwer.
Durch das Aufkommen neuer Technologien und neuer Maschinen kam es auch in manchen Industriezweigen immer wieder zu Arbeitslosigkeit. So zum Beispiel in der Textilindustrie durch die Einführung der Webstühle. In England, aber auch in Frankreich und Spanien führte das bei den Webern zu Arbeitslosigkeit, wodurch es zunächst einmal zu großen Unruhen kam.
Die Arbeitslosen fanden jedoch Schritt für Schritt Arbeit in anderen Industrien und auch in den neu entstehenden Industrien, die zum Beispiel die verschiedenen Maschinen produzierten (Maschinenbau). Da durch den Einsatz der Maschinen die Preise vieler Produkte deutlich sanken, blieb den Konsumenten Geld für den Kauf anderer Waren, die sie sich vorher nicht leisten konnten.
Auch wenn die Situation der Arbeiter damals ‚elend‘ war, gab es keine stärker werdende ‚Verelendung‘, sondern auch der Lebensstandard der Arbeiter verbesserte sich kontinuierlich und gegenüber ihrer vorherigen Situation als Landarbeiter war die Lage ohnehin deutlich besser.
Das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit gab es in der Zeit von 1848 und 1914 nicht; dieser Zeitraum war die liberalste Zeit der Wirtschaftsgeschichte. Manche Industrien florierten, andere schrumpften, und die Arbeiter, die in einem Bereich entlassen wurden, fanden Arbeit in den neuen oder prosperierenden Branchen. Sie konnten auch leicht besser bezahlte Arbeit im Ausland suchen, da es damals keine Migrationsbeschränkungen gab und die Arbeiter die Freiheit hatten, sich auf der ganzen Welt die jeweils bestbezahlten Jobs zu suchen. Über den Welthandel, die Verbreitung der neuen Techninken und die Migration breitete sich der Wohlstand aus; zunächst allerdings nur in der westlichen ‚kapitalistischen‘ Welt.
Dann kam es mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges zu einem großen Einschnitt. Durch die Wehrpflicht und den Kriegseinsatz kam es zu einer großen Knappheit an Arbeitskräften. Diese wurde noch verstärkt durch den zusätzlichen Güterbedarf für den Kriegseinsatz (Waffen, Munition, Bekleidung und Lebensmittel für die Armee). Frauen wurden zur Arbeit in Fabriken herangezogen, was bis dato nicht üblich war. Den Arbeitskräftemangel nutzten die Gewerkschaften aus und trieben die Löhne in die Höhe und in der Folge auch die Güterpreise.
Das änderte sich bei Ende des Krieges schlagartig. Die Kriegswirtschaft hatte die Produktionsmittel an vielen Stellen aufgezehrt und es gab kein Kapital, um sie zu ersetzen. Der Krieg hatte enorme wirtschaftliche Schäden angerichtet und die Welt war verarmt. Der einzige Ausweg lag darin, den Kapitalstock, der im Krieg stark gelitten hatte, wieder durch Investitionen aufzubauen. Um investieren zu können, muss auf der anderen Seite in gleicher Höhe gespart werden, und das bedeutet, dass alle ihren Konsum einschränken mussten.
Nach dem Ende des Krieges und der Rückkehr der Soldaten von der Front wuchs die Zahl der vorhandenen Arbeitskräfte schlagartig wieder an. Viele fanden aber keine Arbeit, da die Güterproduktion nicht in gleichem Maße ausgedehnt wurde, da die Güternachfrage nur vergleichsweise gering anstieg, bedingt auch dadurch, dass viele der Heimkehrer erst einmal keinen Job und kein Einkommen hatten.
Darüber hinaus fiel die Produktion der Kriegswirtschaft weg und die dort beschäftigten Arbeitskräfte konnten nicht sofort in zivilen Bereichen eine Arbeit finden, zum Teil auch weil sie nicht die erforderlichen Qualifikationen hatten. Hinzu kam, dass die Löhne im Krieg stark gestiegen waren, während auf der anderen Seite die Nachkriegspreise aufgrund der Normalisierung der zivilen Produktion und dem entsprechend höheren Güterangebot zunächst sanken. Damit die Unternehmer profitabel produzieren konnten, hätten die Löhne wieder sinken müssen. Das versuchten aber die Gewerkschaften mit aller Macht zu verhindern, mit der Folge, dass sich die Arbeitslosigkeit so drastisch erhöhte, dass die Regierungen sich gezwungen sahen, die entlassenen Arbeiter mit Arbeitslosenunterstützung zu alimentieren. Da sie aber dafür kein Geld hatten, fingen sie an, frisches Geld zu produzieren: die Druckerpresse lief an, es gab Geld für jedermann, allerdings entwertetes Geld, da die Preise genauso schnell stiegen, wie das Geldangebot stieg. Den Arbeitern, die keine Lohnkürzung akzeptierten, wurden die Löhne durch die Geldentwertung verringert.
Der volkswirtschaftlich schädlichste Effekt war allerdings, dass die mögliche Erholung lange dadurch verzögert wurde, dass die Arbeitslosen, die die Produktion bei niedrigeren Löhnen zum Wohle aller viel früher hätten erhöhen können, dies nicht taten.
Ähnliches passierte auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder.
“Permanent mass unemployment destroys the moral foundations of the social order. The young people who, having finished their training for work, are forced to remain idle, are the ferment out of which the most radical political movements are formed. In their ranks the soldiers of the coming revolutions are recruited.”
Ludwig von Mises
Die schlimme Arbeitslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg war also keine Folge des Kapitalismus, sondern sie trat auf wegen der Beschränkungen am Arbeitsmarkt (Eingriffen in die Freie Marktwirtschaft und die freie Preisbildung) und der unmittelbaren Folgen einer kriegerischen Auseinandersetzung, die ein kapitalistisches System versucht hätte, unter allen Umständen im Vorfeld zu vermeiden.
Daraus folgt, dass Arbeitslosigkeit kein Wesenszug des Kapitalismus ist. Ein kapitalistisches System neigt im Gegenteil dazu, die Produktion ständig zu erhöhen und im Gefolge auch die Beschäftigung. Wenn neue Maschinen mehr Güter mit dem Einsatz von weniger Arbeit produzieren, können die überzähligen, frei werdenden Arbeitskräfte entweder in derselben Industrie eingesetzt werden, um z.B. die neuen Maschinen zu warten oder in anderen Branchen, die einen höheren Bedarf an Arbeitskräften haben. Eine freie Marktwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu einem ständig steigenden Güterangebot führt und im Zuge dessen Arbeit für jeden bereitstellt, der arbeiten möchte. Einflüsse von Interessengruppen oder dem Staat können diese Funktionsweise jedoch nachhaltig stören. Wenn die Löhne so stark steigen, dass die Unternehmer nicht mehr profitabel produzieren können, führt das zu einem Rückgang in der Produktion und Arbeitsplätze entfallen. Das gleiche gilt, wenn der Staat über hohe Steuern, investitionshemmende Regularien und überbordende Regulierung das Investitionsklima verschlechtert.
Um die vermeintlich positive Wirkung von Inflation und Lohnsteigerungen auf das Beschäftigungsniveau wissenschaftlich zu ‚untermauern‘ wurde im Jahr 1958 von Alban Philips im Jahr die sogenannte Phillips-Kurve veröffentlicht, die in der Folge von den Anhängern des Keynesianismus aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Der behauptete Zusammenhang wurde aber im Jahr 1972 von dem ‚Österreicher‘ Friedrich von Hayek widerlegt.
Es wird immer wieder behauptet, dass es im Sozialismus keine Arbeitslosigkeit gäbe. Auch wenn das offiziell vielleicht tatsächlich so ist, unter anderem weil es in sozialistischen Ländern sogar eine gesetzliche Pflicht zur Arbeit gibt (bis hin zu „Zwangsarbeit“) , so ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn Menschen zwar offiziell beschäftigt sind, sie in ihrer Arbeitszeit aber nicht richtig produktiv tätig werden können, nennt man das auch ‚verdeckte Arbeitslosigkeit‘. In dieselbe Richtung gehen im Westen sogenannte ‚Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen‘, die viel Geld kosten aber oft keinen Nutzen stiften. Als Beispiel sei hier Keynes‘ Idee angeführt, dass einige Menschen Löcher graben sollten, die dann direkt im Anschluss von anderen wieder zugeschüttet werden.
Letztlich zählt für die Menschen eines Landes und ihre Güterversorgung primär das pro Kopf Einkommen, das erwirtschaftet wird – und da spielt es zunächst einmal keine Rolle, wie viele Menschen das erarbeiten.
In normalen Zeiten gibt es keine Arbeitslosigkeit und in Wachstumsphasen sowieso nicht. Arbeitslosigkeit entsteht in der Krise, und heftigere Krisen treten oft nach exzessiven wirtschaftlichen Boom-Phasen auf, die durch leichtes Geld, das heißt durch staatliches Gelddrucken, ausgelöst werden und die nicht im Rahmen der normalen Zyklen von freien Marktwirtschaften auftreten. Zu Wirtschaftskrisen kommt es auch, wenn Interessengruppen die Produktionskosten so stark erhöhen, dass nicht mehr profitabel produziert werden kann oder der Staat verhindert, dass der Kapitalstock in einer Größenordnung wächst, die mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält (nur dann kann der Lebensstandard steigen) oder über nationalistische Barrieren der internationale Handel behindert wird.
Große Arbeitslosigkeit ist also in aller Regel immer die Folge von politischen Eingriffen in die freie Marktwirtschaft.
Geld, Kredit, Zins
Gutes Geld ist die Basis unseres Wohlstands: Unsere Wirtschaft basiert auf Arbeitsteilung und Tauschhandel und all das basiert wiederum auf Vertrauen. Wenn das Vertrauen verloren geht, wird die Wirtschaftstätigkeit stark beeinträchtigt und es kommt zu erheblichen Reibungsverlusten.
Als Erstes muss man dabei verstehen, was „Geld“ ist, wie „Geld“ entstanden ist.
In den ersten Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte, als die Menschen Jäger und Sammler waren, gab es keine nennenswerte „Arbeitsteilung“: alle ‚jagten und sammelten‘ und es gab nur kleine sich selbst versorgende Einheiten, Familien, kleine Stämme.
Als die Menschen dann in größeren Gruppen zusammenlebten, Dörfern oder kleinen Städten, bildeten sich Spezialisierungen heraus, Berufe wie Schuhmacher, Schreiner, Schmiede entstanden. Diese Arbeitsteilung erhöhte die Effizienz stark, die Produktivität nahm zu.
Aus der arbeitsteiligen Wirtschaft ergab sich die Notwendigkeit, die jeweils produzierten Waren gegen andere zu tauschen, der Tauschhandel begann; zunächst wurden Waren direkt gegen andere Waren getauscht.
Um den Tauschhandel effizienter zu gestalten, wurden mit der Zeit manche Waren als ‚Geld‘, als Tauschmedium allgemein anerkannt. Dies war ein gesellschaftlicher Konsens, niemand wurde gezwungen, das zu akzeptieren, das ergab sich im Laufe der Zeit allein aus den Handlungen der Individuen.
Der Tausch ist die fundamentalste soziale Beziehung und der ‚Markt‘ ist der Dreh- und Angelpunkt einer Wirtschaft.
Auf einem ‚Markt‘ können Arbeitsleistungen und Güter sowie Dienstleistungen nur dann effizient getauscht werden, wenn es ein verlässliches und von allen Marktteilnehmern akzeptiertes Tauschmedium gibt. Aus diesem Bedürfnis der Marktteilnehmer entwickelte sich vor Tausenden von Jahren das „Geld“. Als Geld geeignet sind Waren, die leicht zu transportieren, haltbar und nicht beliebig vermehrbar oder reproduzierbar sind. Geld ist mithin auch eine Ware.
Das erste „Geld“ kam vor etwa 5000 Jahren in Gebrauch, und zwar bei den Sumerern. Es war das „Gerstengeld“. Dem Gerstengeld vertrauten die Leute, denn es war real und man konnte es essen. Weniger praktisch war, dass es recht schwer zu transportieren war. Auch Kühe wurden in manchen Regionen als Geld eingesetzt. Auch das war aber eher ‚unhandlich‘. Es war ein großer Durchbruch der Wirtschaftsgeschichte und erleichterte den Tauschhandel ungemein, als vor etwa 4500 Jahren in Mesopotamien die erste Silberwährung eingeführt wurde, der Silberschekel. Der Silberschekel war ein silbernes Gewicht (8,3 Gramm).
Die ersten Münzen aus Gold und Silber wurden um 640 vor Christus von König Alyattes in Lydien, in der heutigen Westtürkei, geprägt. Der Prägung war das Gewicht des Edelmetalls zu entnehmen. Solange die Menschen der Regierung vertrauten, die hinter der Prägung stand, vertrauten sie auch den von ihr herausgegebenen Münzen.
Praktisch in der ganzen Welt galten früher oder später Münzen aus Edelmetallen als Währung, es gab insofern quasi weltweit eine einheitliche Währungszone. Das erleichterte den internationalen Handel, der bereits in der Antike recht ausgeprägt war.
Als „Geld“ entstand, war es also immer eine Ware, die einen eigenen Nutzwert hatte. ‚Echtes‘ Geld entsteht wie jedes andere Gut oder jede andere Dienstleistung, es wird erarbeitet, z.B. dadurch, dass Gold geschürft wird. Alles andere ist „Geld-Ersatz“, ein Geld-Substitut, „Kredit-Geld“. Nur wenn mit Gold-Geld bezahlt wird, erhält der Verkäufer einen echten Gegenwert für seine Waren oder Dienstleistungen, andernfalls erhält er nur ein Zahlungsversprechen.
Betrogen wurde von den Emittenten des (Münz-)Geldes auch damals schon, und zwar indem man den Edelmetallanteil der Münzen manipulierte.
Der Betrug im richtig großen Stil wurde allerdings erst mit der Einführung des Papiergeldes (auch genannt ‚Fiat money‘) möglich.
Das erste Papiergeld wurde um das Jahr 1000 herum in China eingeführt, Ende des 13. Jahrhunderts versuchte sich der persische König mit Papiergeld finanziell zu sanieren. Das Papiergeld wurde üblicherweise unter Zwang eingeführt und die Experimente gingen nie lange gut. In Europa kam Papiergeld zuerst in Spanien Ende des 15 Jahrhunderts ins Spiel. Anfangs war das „Papiergeld“ in Europa meistens durch Gold oder Silber gedeckt, insofern als es sich um Quittungen handelte für bei Goldschmieden, Juwelieren oder Banken hinterlegtes Gold oder Silber, die beim jeweiligen „Emittenten“ eingelöst werden konnten. Diese leichter als der Gegenwert in Gold oder Silber zu transportierenden Quittungen wurden als Zahlungsmittel eingesetzt und erleichterten den Handel.
Bei „Papiergeld“ muss man unterscheiden in solches, das von dem Emittenten mit einem bestimmten Anspruch auf echte Werte/Güter, wie z.B. Gold, herausgegeben wird – also eine goldgedeckte Währung – und ‚fiat money‘-Papiergeld, das keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge an echten Waren repräsentiert; dieses Geld könnte man „Schuldengeld“ nennen, es ist ungedeckt und hat keinerlei eigenen Wert außer dem, der auf dem Vertrauen in das System beruht und entsprechend auch nur so lange existiert, wie das Vertrauen in das System besteht.
Der Wert von Papiergeld ist nicht ‚echt‘, denn der Wert des bedruckten Papiergelds existiert nur in unserer Fantasie und basiert auf dem Vertrauen, dass der Schuldner auch in der Lage ist, seine Schulden zurückzubezahlen.
Fiat-Geld ist ein Zettel, den der Emittent selbst nie mehr selbst einlösen wird und für den der Inhaber des Zettels die Hoffnung haben kann, dass ihm ein Dritter dafür Waren gibt. Es ist also ein weitgehend leeres Versprechen beziehungsweise eines, das nicht dauerhaft fundiert ist.
Wenn Zentralbanken ungedecktes Geld in Umlauf bringen oder Geschäftsbanken über ihren Mindestreservesatzhebel frisches Geld kreieren, sind diese Gelder weitestgehend ungedeckt, es haften nur die Banken selbst. Alles baut auf dem Vertrauen auf, dass die Banken in der Lage sein werden, ihren Verpflichtungen nachzukommen – und oft genug in der Geschichte wurde dieses Vertrauen missbraucht
Wohin es führen kann, wenn der Staat exzessiv Geld druckt, konnte man in Deutschland in der Weimarer Republik in den Zeiten der Hyperinflation sehen; wir reden vor allen Dingen über das Jahr 1923.
Der Druck einer 500 Euro Note kostet fast nichts; problematisch wird es nur dann, wenn das Geld so weit entwertet ist, dass der Druck fast so viel kostet wie die frisch erzeugten 500,– Euro. Die Druckkosten lagen zum Schluss bei etwa einem Drittel des Wertes des bedruckten Papiers ausmachten – und das bei Scheinen im Nominalwert von 100 Billionen Mark. Für 100 Milliarden Reichsmark bekam man damals gerade mal ein Brot.
Im Jahr der Hyperinflation 1923 arbeiteten bis zu 133 Fremdfirmen mit fast 2000 Druckmaschinen Tag und Nacht für die Reichsdruckerei, um die Menschen jeden Tag mit frischem Papiergeld zu versorgen, das immer schon am selben Tag einen großen Teil seines Wertes wieder einbüßte. 30 Papierfabriken stellten das dafür erforderliche Banknotenpapier her. 30.000 Menschen und zahllose Lastwagen waren mit dem Druck und Transport der Scheine beschäftigt – es war eine immense Verschwendung von Ressourcen.
Das sollte im Übrigen auch denjenigen Umweltschützern zu denken geben, die gerade mit ihren „Green New Deals“ Tausende von Milliarden frisches Geld in Umlauf bringen möchten, um die Welt zu retten.
Eine weitere „Quelle“ frischen Geldes ist der ‚Kredit‘. Wenn im Geschäftsleben von knappem Geld oder einer Geldschwemme gesprochen wird, ist im Allgemeinen der Kreditmarkt gemeint, nicht das Bargeld. Über die durch die Zentralbank gedruckten Papiergeldscheine hinaus gibt es in einem ‚fiat-money‘-System das ‚Zentralbankgeld‘ beziehungsweise das ‚Buch- oder Giralgeld‘. Als Zentralbankgeld bezeichnet man die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, die durch Kredit auf hinterlegte Wertpapiere entstehen können oder durch eine ungedeckte Kreditvergabe der Zentralbank an die Geschäftsbanken. Buchgeld entsteht, wenn Geschäftsbanken an Endkunden Kredite vergeben. Über die Festsetzung der Quoten, die eine Bank als Eigenkapital und/oder Reserven vorhalten muss, entsteht eine große Hebelwirkung, die es den Banken erlaubt, ein Vielfaches der Kundeneinlagen und des Eigenkapitals als Kredite in Umlauf zu bringen. Diesen Hebel nennt man ‚Mindest-Reserve-Sätze‘, das System ‚fractional reserve banking‘. ‚Gedeckt‘ sind die Forderungen gegen die Banken zum größten Teil nur durch die Schulden Dritter.
Je niedriger die Mindestreserveanforderungen an die Geschäftsbanken sind, desto mehr fremdes Geld können die Banken auf eigene Rechnung verleihen und an der Marge Geld verdienen. Daher haben die Banken kein Interesse daran, den Hebel zum Geldverdienen zu verkleinern. Bei einem Mindestreservesatz von zum Beispiel 10% (der Einlagen) kann die Bank über fortlaufende Kreditgewährung Geld in Höhe des Zehnfachen der Einlage ‚schöpfen‘, bei einem Mindestreservesatz von 20% wäre nur das Fünffache möglich.
Der Staat hat ebenfalls kein Interesse daran, das System zu verändern und auf eine solide Basis zu stellen, denn mit der Geldflut finanziert er seine Bürokratie, die Wohltaten, mit denen Wählerstimmen gekauft werden und fragwürdige Abenteuer, wie Kriege, Energiewenden oder „Weltpolitische Maßnahmen“.
Die insgesamt vorhandene Geldmenge kann also rein technisch oder buchhalterisch stark erhöht werden, ohne dass sich gleichzeitig in der Realwirtschaft oder am Volksvermögen etwas tut.
Wenn Geld gedruckt wird, erhöht das nicht das Vermögen oder den Wohlstand der Bürger!
Dem globalen Geldvermögen steht als „Deckung“ ein ebenso hoher Betrag an Schulden gegenüber. Erst in zweiter Linie ist das Geld durch die vorhandenen Waren „gedeckt“, es gibt jedoch keinen Anspruch auf Erhalt einer bestimmten Warenmenge gegen Hergabe eines Papiergeldscheins. Und das kann dann zu Problemen führen, wenn der Besitzer der Ware dem Geld, das er im Gegenzug erhalten soll, nicht mehr traut und die „Annahme verweigert“.
Die Bürger sind mehr oder weniger per Gesetz gezwungen, das böse Spiel mitzuspielen, denn die Regierungen erklären ihr eigenes ungedecktes Geld zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel und verhindern aktiv die Entstehung von werthaltigeren Parallelwährungen.
Seit im Jahr 1971 die Golddeckung in USA endgültig abgeschafft wurde, leben wir in einer reinen ungedeckten Papiergeldwelt (‚fiat money‘) und die Staaten haben ihr Monopol auf das Geld seitdem weidlich ausgenutzt. Darauf aufbauend hat sich die globale Verschuldung in den letzten Jahren massiv erhöht, auf inzwischen über 250 Billionen US-Dollar (Stand 2020; gegenüber 173 Billionen zur Zeit der Lehman-Krise im Jahr 2007).
Dass unser derzeitiges System der fiat-Währungen bislang noch hält, liegt zum einen daran, dass es bislang wenig „Fluchtmöglichkeiten“ gab, da alle größeren Währungsräume parallel inflationieren, und zum anderen daran, dass den meisten Bürgern die Gefahren nicht bewusst sind – auch weil es bislang zumindest auf den Gütermärkten wenig wahrnehmbare inflationäre Tendenzen gibt (die ‚Inflation‘ spielt sich aktuell an den Immobilienmärkten und Wertpapiermärkten ab). Dass die offiziellen Preissteigerungsraten in den letzten 40 Jahren niedrig waren, ist der Sondersituation zu verdanken, dass über Demographie, die Globalisierung und hier vor allen Dingen die Einbindung von China in die Weltwirtschaft ein riesiges zusätzliches Arbeitsangebot auf den Markt gekommen ist, das die Löhne und die Warenpreise konstant gedrückt hat. Dieser Effekt wird sich jedoch vermutlich bald umkehren.
In der Geschichte hat noch nie ein ungedecktes Papiergeldsystem überlebt – und dieses Mal wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit genau so enden.
Dieses Mal könnte das Aufkommen der Kryptowährungen oder alternativer ‚privater‘ gold- oder anderweitig ‚gedeckter‘ Währungen dem Inflationieren der Staaten und ihrem fiat-money System ein Ende bereiten – nämlich dann, wenn das Vertrauen der Bürger in das ungedeckte Papiergeld weiter schwindet und sie diese Fluchtmöglichkeit vermehrt nutzen. Dann wird die massive ungedeckte staatsmonopolistische Geldschöpfung, der ‚Geldsozialismus‘, erneut als ein gigantischer Betrug an den Bürgern, ein riesiges „Ponzi-Scheme“ (Schneeballsystem) entlarvt werden.
„Money is gold, nothing else.“
John Pierpont Morgan
Jetzt kommen wir zum ‘Preis’ des Geldes, dem ‚Zins‘, den der Kreditnehmer an den Kreditgeber bezahlt. Geld per se ist unproduktiv und generiert allein keine Rendite. Produktiv ist nur ‚Arbeit‘ im weitesten Sinn, die Arbeit des Unternehmers in Verbindung mit den anderen Produktionsfaktoren, darunter auch das ‚Kapital‘.
Ein Unternehmer kann benötigtes Kapital – z.B. für geplante Expansionen – aus dem Verkauf der von ihm produzierten Güter und den daraus erzielten Gewinnen generieren, oder aber am Markt als Kredit aufnehmen. Wenn er Kredit aufnehmen kann, kann er heute Rohmaterialien oder Maschinen kaufen, ansonsten muss er bis ‚morgen‘ warten, bis er selbst die entsprechende Liquidität aus seinen Gewinnen generiert. Das heißt, wenn der Unternehmer Kredit bekommt, kauft er nicht ‚Geld‘ sondern ‚Zeit‘. Den Zins bezahlt er dafür, dass er heute haben kann worauf er ansonsten bis morgen warten müsste.
Der Wert eines Gutes heute ist immer höher als der eines Gutes, das erst in der Zukunft zur Verfügung steht. Daher ist die gebräuchlichste Form eines kommerziellen Kredits die Diskontierung, bei der ein Kreditgeber, in der Regel eine Bank, dem Kreditnehmer für einen Zahlungsanspruch in z.B. 90 Tagen (Geldforderung, ‚Wechsel‘..) heute schon den Nennwert der Forderung abzüglich eines Betrags, der auf Basis des ‚Diskontsatzes‘ (Zinssatz) berechnet wird, ausbezahlt. Der Unternehmer bezahlt den Zins, wenn ihm das Geld heute entsprechend mehr Rendite liefern wird über seine unternehmerische Verwendung als er an Zinsaufwendungen haben wird.
Geld heute ist normalerweise immer mehr wert als Geld in der Zukunft (anders kann es unter verzerrten Marktbedingungen wie heute mit negativen Zinsen sein, Stand 2020). Es ist ein Vorteil, Geld heute in der Hand zu haben, anstelle von morgen. Man kann es dann ad hoc einsetzen bei günstigen Gelegenheiten oder zur Umsetzung interessanter Projekte. Geld an sich produziert allerdings keine Renditen. Wenn daher jemand anbietet, das Geld zu interessanten Konditionen zu leihen, und dieser Mehrwert die Vorteile übersteigt, das Geld sofort verfügbar zu haben, wird man es verleihen, wenn der entsprechende sofortige Zinsvorteil den möglichen zukünftigen Nutzen übersteigt. Der Verleiher diskontiert insofern auch Zeit.
Was wird also den Zins beeinflussen, den Preis von Geld? Nicht mehr und nicht weniger als Angebot und Nachfrage nach Geld.
Der ‚Marktzins‘ wird aber zusätzlich noch von psychologischen Faktoren beeinflusst, von Zukunftsperspektiven und den Einflüssen der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben einen sehr großen Einfluss auf die Höhe des Zinses, weil sie über ihr Geldmonopol wichtige Zinssätze ‚festsetzen‘ können. Ihre Macht ist aber nicht unbeschränkt und endet spätestens dann, wenn die Bürger das Vertrauen in das staatliche Papiergeld verlieren.
Bei der Bestimmung der Höhe des Marktzinses spricht man auch von der ‚Zeitpräferenz‘. Waren oder Dienstleistungen, die man heute bezieht, halten die Menschen in aller Regel für wertvoller als der Bezug derselben Leistung in der Zukunft. Und wenn Menschen ihr Geld verleihen und dafür auf Konsum verzichten, wollen sie dafür entschädigt werden – das ist der Preis des Geldes, der Zins. Die Höhe hängt ‚am Markt‘ davon ab, wieviel freies Geld zur Verfügung steht und wie viele Menschen sich Geld leihen möchten für Investitionen oder für vorgezogenen Konsum.
„Satisfaction of a want in the nearer future is, other things being equal, preferred to that in the farther distant future. Present goods are more valuable than future goods.”
Ludwig von Mises
Finanzierung
Banken waren traditionell die Institutionen, zu denen die Sparer ihr Geld brachten und von denen die Unternehmer Kapital für ihre Investitionen erhalten konnten. Die Banken konnten, wenn sie ihre Sache ordentlich machten und die geplanten Investitionen ihrer Schuldner richtig einschätzten, an der sogenannten Zinsmarge gutes Geld verdienen. Bei den Zinsmargen unterscheidet man zwischen Sparmarge, der Transformationsmarge und der Kreditmarge.
Unternehmen haben jedoch auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Sie können Geld am Kapitalmarkt (Börse) aufnehmen in Form von Anleihen oder über die Ausgabe von Aktien (Beteiligungen) oder aber über private außerbörsliche Beteiligungen (Private Equity, Venture Capital). Aktien- und Anleihen-Platzierungen über die Börse lagen traditionell ebenfalls in den Händen der Banken und waren eine schöne Einnahmenquelle.
Wichtige Geldquellen für Unternehmen sind dabei Kapitalsammelstellen wie Fonds (offene Fonds oder geschlossene Fonds).
Finanzinnovationen machen die Banken jedoch seit einigen Jahren mehr und mehr entbehrlich (z.B. Crowd Funding, Kreditvermittlungsplattformen).